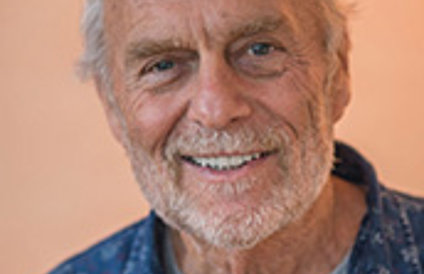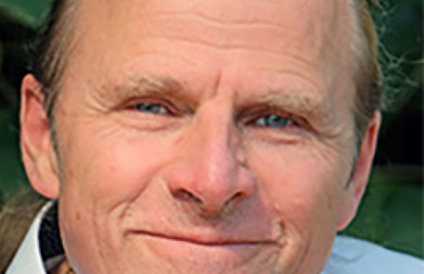Sie gilt als schwer zu erkennen und mitunter schwierig zu behandeln: die Borreliose. Während in der Schulmedizin Antibiotika als Mittel der Wahl gesehen werden, gehen Naturheilkundler gänzlich andere, ganzheitliche Wege.
Was ist eine Borreliose?
Als Borreliose bezeichnet man die bakterielle Infektion des Körpers durch das zu den Spyrochäten gehörenden Bakterium Borrelia burgdorferi und dem sich daraus entwickelnden Krankheitsbildern.
Nachdem Borrelien sich im Körper über den Blutkreislauf verteilen können, können alle Körperteile bzw. Organe befallen werden. Daraus entwickeln sich die verschiedensten Symptomatiken bzw. Krankheitsbilder, je nachdem, wo diese Parasiten sich manifestieren.
Das macht die Zuordnung dieser Krankheitsbilder so komplex, und die Verwechslungsgefahr mit anderen ähnlichen Erkrankungen ist sehr hoch. Deswegen wird die Borreliose auch als Chamäleon der Infektionserkrankungen bezeichnet.
Nachdem in der Regel nicht nur ein Organ befallen wird, sondern sich viele Borrelienherde im Körper gleichzeitig ansiedeln, spricht man von einer Multisystemerkrankung. Borrelien können durch Zecken, aber auch durch andere stechende oder beißende Insekten wie z. B Stechmücken, Bremsen oder Flöhe auf den Menschen übertragen werden. Borrelien kommen außer in den Überträgern selbst in vielen anderen Säugetierarten vor.
Die Borreliose wurde in den 1970er Jahren im Ort Lyme im US-Bundesstaat Connecticut erstmals beobachtet. Das Bakterium Borrelia burgdorferi wurde dann durch Willy Burdorfer erstmals 1981 beschrieben.

Die "Zeckenimpfung"
Als Zeckenimpfung wird irreführenderweise die FSME-Impfung bezeichnet. Die FSME wird ebenfalls durch Zecken übertragen, hat mit der Borreliose außer dem gemeinsamen möglichen Übertragungsweg nichts zu tun. Die Zeckenimpfung schützt weder vor Zecken noch vor einer möglichen Borreliose.
Stadien der Borreliose
Die Borreliose wird von der Schulmedizin in drei verschiedene Stadien eingeteilt.
- Als Stadium I bezeichnet man die Zeit der ersten vier Wochen nach der Infektion.
- Als Stadium II wird die Zeit nach vier Wochen (Stadium I) bis zu einem halben Jahr nach der Infektion bezeichnet, in der sich die Borreliose im Körper manifestiert und das Immunsystem des Betroffenen versucht, dieser Infektionskrankheit Herr zu werden.
- Als Stadium III wird die Zeit nach einem halben Jahr nach der Infektion bezeichnet, nachdem das Immunsystem die Infektionserkrankungen nicht bezwingen konnte, sich der Parasit, die Borrelie, im Körper manifestiert hat, und es somit zu einer chronischen Borreliose gekommen ist.
Da die Stadieneinteilung überschneidend ist, lassen sich die Stadien nicht klar voneinander abgrenzen. Das Festsetzen eines Stadiums sagt nichts über die Erfolgsaussichten einer wirkungsvollen Behandlung aus.
Die Gelenksborreliose
Von einer Gelenksborreliose wird gesprochen, wenn sich Borrelien in den Gelenkflächen angesiedelt haben und es dadurch zu Gelenkschmerzen kommt. Sie bezeichnet nicht einen komplizierteren Krankheitsverlauf, sondern drückt nur den Ort des Geschehens aus.
Verblüffender Weise tritt eine Gelenksborreliose verstärkt das erste Mal nach einer Antibiotikagabe auf. Das lässt den Verdacht zu, dass die im Gewebe vorkommenden Borrelien sich während der Antibiose in die schlecht durchbluteten Gelenksflächen flüchten, um sich den Auswirkungen der Antibiose zu entziehen. Ab dem Moment treiben die Borrelien auch in den Gelenksflächen ihr Unwesen - mit den daraus resultierenden Beschwerdebildern.
Die Neuroborreliose
Man spricht von einer Neuroborreliose, wenn im Verlauf einer Borreliose Beschwerden im Bereich der Nerven hinzukommen, sich neuropathische Schmerzen einstellen oder Sensibilitätsstörungen den Patienten plagen. Ebenfalls spricht man von einer Neuroborreliose, wenn anscheinend die Leistungsfähigkeit des Gehirns in Mitleidenschaft gezogen wird. Dies äußert sich zum Beispiel durch Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen sowie Sehstörungen.
Verblüffender Weise klagen die Patienten über diese Symptomatik oft zum ersten Male nach einer antibiotische Behandlung. Analog zur Gelenksborreliose liegt der Verdacht nahe, dass sich Borrelien während der Antibiose in das für Antibiotika schwer zugängliche Nervensystem zurückziehen und ab diesem Zeitpunkt über ihre Ausscheidungen das Nervensystem schädigen.

Diagnostik der Borreliose - Detektivspiel mit ungewissem Ausgang
Labordiagnostik - Bluttests
Die Schulmedizin bietet für die Diagnostik der Borreliose verschiedene Bluttests an. Dabei achtet der Mediziner in erster Linie auf diesen diagnostischen Wert und zieht das Befinden und die Beschwerden des Patienten oftmals zu wenig in die Beurteilung der Gesamtsituation mit ein.
So kommt es leider immer wieder vor, dass ein negativer Laborwert den Mediziner veranlasst, den Patienten für gesund zu halten. Die Beschwerden werden dann in die Psychosomatik eingruppiert.
In diesem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass die Laborwerte bzw. die Laboruntersuchungen nicht standardisiert sind und folglich unterschiedlich ermittelt werden. Das hat zur Konsequenz, dass im Labor A das Ergebnis positiv und im Labor B das Ergebnis negativ sein kann.
Was die meisten Betroffenen auch nicht erkennen, ist, dass nicht nach Borrelien sondern nach Antikörpern gegen Borrelien gesucht wird. Das ist natürlich ein eklatanter Unterschied. So wird ebenfalls unterstellt, dass die Anzahl der Borrelien mit der Anzahl der Antikörper korreliert. Damit ist gemeint: Wenig Borrelien bedeutet wenig Antikörper, viele Borrelien bedeutet viele Antikörper. Diese Unterstellung einer Korrelation zwischen Antikörper und Borrelien ist schlichtweg falsch.
Diese Fehlinterpretation lässt sich sehr einfach darlegen. Antikörper werden im Körper vom Immunsystem als Antwort auf eine Infektion gebildet, sofern das System zu dieser Antwort noch in der Lage ist. Kann das Immunsystem, warum auch immer, nicht mehr antworten, werden im Körper selbst bei einem hohen Erregerbefall keine Antikörper mehr gebildet. In diesem Falle wäre das Testergebnis schlichtweg falsch, da nach schulmedizinischer Sicht keine Borreliose vorliegt, da keine Antikörper nachzuweisen sind.
Hat ein Betroffener ein hervorragendes Immunsystem, das sehr schnell und gut mit der Bildung von vielen Antikörper auf einen geringen Erregerbefall reagiert, was grundsätzlich ein gutes Zeichen wäre, wird dieses Testergebnis fälschlicherweise als hoher Befall interpretiert, obwohl speziell in diesem Falle das Immunsystem mit diesem Erregerbefall hervorragend und physiologisch korrekterweise umgeht und höchstwahrscheinlich keinerlei Therapie notwendig wäre.
Im Moment ist der Western-Blot der gängigste Test bei der Diagnostik der Borreliose. Dabei wird das Blut auf die Anzahl der Antikörper untersucht. Dieser Test sagt lediglich aus, ob der Betroffene irgendwann in seinem Leben Kontakt mit dem Erreger hatte.
Der LTT-Test bzw. Lymphozytentransformationstest erfasst die für Borrelien spezifischen T-Zellen im Blut, also auch eine Reaktion des Körpers auf den Erreger. Damit ist der Test ähnlich schwierig zu interpretieren wie der Antikörpertest, da auch hier die Reaktionsfähigkeit des Körpers maßgeblich ist. Trotzdem gilt der LTT-Test als einer der sichersten Testverfahren.
Der PCR Test, bzw. Polymerase Ketten Reaktionstest (Polymerase Chain Reaction) ist eine Methode, um die Erbsubstanz in diesem Falle der Borrelien zu vervielfältigen. Dazu wird das Enzym DNA-Polymerase verwendet. Diese Vervielfältigung läuft in vielen hintereinander geschalteten Schritten ab und entsprechend hoch sind die Fehlergrenzen und die Falschaussagen bzw. unzuverlässig ist der Test.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass diese Tests lediglich ein Indiz für eine mögliche Borrelien-Infektion sind. Eine klare Diagnostik lässt sich hieraus in keinem Falle ableiten.
Es ist für viele Patienten (und Mediziner) kaum zu glauben, dass es in der heutigen Zeit keinen vernünftigen und damit zuverlässigen Test für eine Borreliose gibt. [Anm. d. Red.: Wie unsicher die Diagnosen bei der Borreliose mitunter sind, zeigte auch eine Warnung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie vor Fehldiagnosen. Demnach würden viele Patienten aufgrund einer vermeintlichen chronischen Borreliose zum Teil monatelang mit Antibiotika behandelt, ohne überhaupt daran erkrankt zu sein. (Quelle: Meldung der DGN vom 22.9.2016 beim idw)]
Erythema migrans
Das Erythema migrans (Wanderröte) – eine sich kreisrund ausbreitenden Rötung der Haut rund um den Zeckenstich - "gilt" als sicheres Zeichen für eine Borreliose. Bei genauerer Betrachtung darf der aufmerksame Leser feststellen, dass es sich hierbei um ein Postulat handelt, sprich eine Behauptung, die wissenschaftlich nicht nachgeprüft ist.
Kein Wissenschaftler der Welt weiß definitiv, ob das Erythema migrans wirklich von Borrelien verursacht wird, oder ob es andere Ursache hat. Sicher ist nur, dass das Erythema migrans eine physiologisch korrekte Immunreaktion des Körpers auf einen Fremdeiweißeintrag in das Gewebe ist.
Die bisher gültige schulmedizinische Meinung - Auftreten des Erythemas gleich Borreliose - ist wissenschaftlich nicht haltbar. Umgekehrt tritt die Wanderröte bei Weitem nicht immer auf: Tatsächlich geht man davon aus, dass das Erythema migrans nur in ca. 30 % der Fälle einer Borreliose-Infektion auftritt.

Das Beschwerdebild der Borreliose
Die Borreliose kann mit einer Fülle von Beschwerden einhergehen, wie:
chronisches Krankheitsgefühl, Ermüdung, Erschöpfung, herabgesetzte körperliche Belastbarkeit, leichtes Fieber, Hitzewallungen, Frösteln, Nachtschweiß, Halsschmerzen, geschwollene Drüsen, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Gelenkschmerzen mit Wanderungstendenz in verschiedenen Gelenken, Steifigkeit der Gelenke, Entzündung von Gelenken, Muskelschmerzen, Brustschmerzen und Herzklopfen, Bauchbeschwerden, Übelkeit, Durchfälle, Schlafstörungen, schlechte Konzentration und Gedächtnisstörung, Nervosität und Stimmungsschwankungen, Depression, Benommenheit, Rückenschmerzen, verschwommenes Sehen und Augenschmerzen, Schmerzen im Kieferbereich, Schmerzen in den Hoden oder im Beckenbereich, Schwindelzustände, Tinnitus, Hirnnervenstörungen (Taubheitsgefühl, Schmerzen, Kribbeln im Gesichtsbereich), Lähmungen im Gesichtsbereich einschl. Augenmuskeln, Optikus-Neuritis (Augennerventzündung), Kribbeln oder brennende Schmerzen im Hautbereich, Erkrankung des Herzmuskels inkl. des Erregungsleitungssystem, Herzrhythmusstörungen, Gewichtsverlust ...
Wie bereits erwähnt kann fast jedes Beschwerdebild von Borrelien wenigstens mit verursacht werden, je nachdem in welchem Körperabschnitt bzw. Organ die Borrelien ihr Unwesen treiben. Hinzu kommt, dass sich die möglichen Beschwerden einer Borreliose zu mehr als 90 % mit dem Beschwerdebild der Schwermetallvergiftung decken. Differenzialdiagnostisch kann daher eine Borreliose nicht eindeutig von anderen Krankheitsursachen abgegrenzt werden.
Schulmedizinische Therapie der Borreliose
Viele Schulmediziner richten sich nach der so genannten S1-Leitlinie der Neurologen. Eine weitere S1-Leitlinie gibt es bei den Dermatologen bezüglich der Hautmanifestation. Beide Leitlinien empfehlen das Antibiotikum Doxycyclin oder Amocycillin in einer Dosierung von täglich 200 mg über 2 bis 3 Wochen. Nach der Leitlinie ist die Borreliose anschließend geheilt und die Beschwerden des Patienten sind anderer Natur. Dann spricht man vom postinfektiösem Syndrom bzw. Post Lyme Disease.
Bei einer Spätinfektion wird nach dieser Leitlinie eine intravenöse Gabe von Cephalosporinen empfohlen. Spätestens soll die Borreliose ausgeheilt sein. Die Leitlinie spricht von einer Heilungsrate von 85 bis 100 %. Offen bleibt bei dieser Leitlinie, wie mit den ca. 15 % Verfahren werden soll, welche auf diese Weise nicht ausgeheilt worden sind.
In der Praxis stellt sich dieses Bild meiner Erfahrung nach jedoch völlig anders dar. Etliche Patienten haben mehrfache Antibiotikakuren hinter sich gebracht, ohne eine nachhaltige Besserung zu erfahren.
Die Ärztevereinigung ILADS, die sich ausschließlich mit Zecken übertragene Erkrankungen beschäftigt, empfiehlt eine Kombination von drei verschiedenen Antibiotika über wenigstens sechs Monate. Welche Auswirkungen das auf den menschlichen Organismus hat, darf sich jeder Betroffene selbst ausmalen. [Anm. d. Red. Wie neue Untersuchungen zeigen, ist selbst bei einer Neuroborreliose eine Antbiotikatherapie über mehr als 2-3 Wochen nicht sinnvoll. Sie stelle sogar ein unnötiges Risiko dar.]
Weitere Therapieoptionen (außer Antibiotika) stehen der Schulmedizin nicht zur Verfügung.
Anzumerken ist jedoch noch, dass diese Leitlinie derzeit überarbeitet wird (Stand Oktober 2015). Es bleibt daher abzuwarten, ob die neu überarbeitete Leitlinie der schwierigen Situation der Betroffenen besser gerecht wird.
Naturheilkundliche Therapie bei Borreliose
Literatur- und Linktipps
- Udo Becker: Lexikon der Symbole.
- Lothar Burgerstein, Michael Zimmermann, Hugo Schurgast und Uli P. Burgerstein: Burgersteins Handbuch Nährstoffe.
- Ruediger Dahlke: Krankheit als Symbol.
- Wolfgang Gerok u. a.: Die Innere Medizin.
- Helmut Hahn u. a.: Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie.
- Rudolf Klussmann: Psychosomatische Medizin.
- Wolf-Dieter Storl: Borreliose natürlich heilen.
- www.borreliose-bund.de - Bundesverband der Borreliose-Selbsthilfegruppen
- www.borreliose.org - Informationen rund um Borreliose und andere Zeckeninfektionen
- www.bzk-online.de - Homepage des Bundesverbandes der Zeckenkrankheiten
- Liliane, am 07.07.2022Sehr geehrter Herr Beinweiler,
unsere Tochter (6 Jahre) hatte nach dem Zeckenbiss zeitweise Kopfschmerzen und plötzlich auftretende juckende Ausschläge am ganzen Körper. Der Kinderarzt fand die Bissstelle aber unbedenklich und sah keinen Zusammenhang, weswegen wir zunächst nicht behandelten. 3,5 Wochen nach dem Biss entwickelte sich jedoch eine Wanderröte. Alle befragten Ärzte (wir haben mehrere Kinderärzte im Freundeskreis) empfahlen dringend umgehende Antibiotikagabe für mindestens 2 Wochen. Seit 12 Tagen nimmt unsere Tochter nun Amoxicillin. Der Heiplraktiker empfahl uns die gleichzeitige Gabe von Rizol Gamma (2x1Tropfen) und sie nimmt Combi FLora Kids, um ihr Mikrobiom ein wenig zu unterstützen. Nun hören wir immer wieder (u.a. von Dr. Klinghardt), dass die Antibiotika 4-6 Wochen lang gegeben werden müssen, um wirksam zu sein und uns wurde empfohlen, nach 2 Wochen das Antibiotikum zu wechseln. Natürlich möchten wir eine so lange Antibiotikagabe möglichst verhindern. Unser Heilpraktiker meinte nun, es genüge, noch 2 Wochen mit dem Rizol und immunstärkend weiterzuarbeiten. Macht das Sinn, nachdem wir nun schon mit Antibiotika begonnen haben oder begünstigen wir dadurch einen persistierenden Verlauf / die Wahrscheinlichkeit, dass zu einem späteren Zeitpunkt doch wieder Symptome auftreten? Wir sind sehr verunsichert, was der richtige Weg ist. Danke für ihre Unterstützung!! Mit verzweifelten und sehr besorgten Grüßen, Liliane- Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 07.07.2022Hallo Liliana,
die einzigste Option, die die Schulmedizin bei einer parasitären Erkrankung wie z. B. einer Borreliose zu bieten hat ist die Gabe von einem oder mehreren Antbiotikum/Antibiotika. Erfahrene Kollegen im parasitären Bereich wissen und bestätigen, dass allein mit einer Antibiose eine parasitäre Behandlung langfristig wenig erfolgversprechend ist, sondern eine naturheilkundliche Begleitung angezeigt ist. Meiner Meinung und Erfahrung nach ist eine Borreliose therapeutisch sehr gut und erfolgreich naturheilkundlich behandelbar auch ohne eine Antibiose, die „nur“ die Erregeranzahl dezimiert, diese aber nicht eliminiert.
Das von Ihnen angesprochene Rhizol ist eine sinnvolle Option. Ob dies alleine ausreicht, wage ich zu bezweifeln, da es zwar stark antiparasitär wirkt, aber nicht gleichzeitig das Immunsystem unterstützt. Ob die von dem Kollegen durchgeführte immunstärkende Therapie ausreichend ist, wird sich zeigen.
In meiner Praxis ist die umfangreiche immunstimmulierende Therapie der Hauptansatz der Behandlung - verbunden mit der Ernährungskorrektur auf eine artgerechte Ernährung. Eine Antibiose ist nicht zwingend notwendig für eine erfolgreiche naturheilkundliche Therapie.
Weitere Informationen zur Borreliosethrerapie und der artgerechten Ernährung finden Sie auf meiner Homepage. Für spezifische Fragen dürfen Sie gerne einen orientierenden Beratungstermin vereinbaren, indem wir diese klären.
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler
- David, am 18.12.2020Sehr geehrter Herr Berweiler,vielen Dank erstmal dass Sie mit Ihrer Arbeit so vielen Menschen helfen. Sowas schätzt man viel zu wenig. Die ersten Symptome bei meiner Freundin traten vor einigen Wochen im Schlaf auf. Es fing in ihrer linken Wade an mit einem kribbelnden Brennen sowie Taubheitsgefühlen. Diese Symptome wechselten dann auch zu ihrem Arm, das variierte dann fast täglich. Mal war das Kribbeln weg mal war ein Finger taub, mal war es der Zeh oder an einem anderen Tag auch der ganze Arm oder das Bein wie komplett eingeschlafen. Das machte sie dann so unruhig dass ich sie ins Krankenhaus brachte. Daraufhin haben sie mehrere Untersuchungen gemacht, allerdings alles in Richtung Thrombose, Schlaganfall, Hirntumor und MS, was ihre Angst vor einer ernsten Krankheit sehr verschlimmerte. Das MRT zeigte keine Auffälligkeiten und alle neurologischen Untersuchungen waren in Ordnung. Das ausführliche Ergebnis der Liquor-Untersuchung steht noch aus, war aber hinsichtlich MS soweit unauffällig.Es wurden allerdings Borreliose Antikörper im Blut entdeckt in grenzwertiger Anzahl - Wobei ich jetzt weiß dass das keine Aussagekraft besitzt! Zum Glück konnte meine Freundin sich an einen Stich an ihrem linken Schienbein erinnern den sie im August in Italien bekommen hatte, sie besitzt sogar ein Foto davon. Es gab keine typisch ringförmige Ausbildung aber es war ein runder roter Fleck (ca.4cm im Durchmesser)zu sehen, inklusive einer starken Schwellung des linken Knies und der Stichstelle. Wir hatten keine Zecke entdeckt und gehen jetzt von einer infizierten Mücke aus. Zudem war es auch das linke Bein an dem die ersten Symptome auftraten. Wir haben uns zu der Zeit keine Sorgen gemacht und dachten es wäre eine allergische Reaktion auf einen Mückenstich. Der Arzt war sich, nachdem meine Freundin ihm die Bilder zeigte ziemlich überzeugt und verschrieb ihr 200mg Doxycyclin täglich über drei Wochen einzunehmen. Mittlerweile habe ich einige Informationen im Internet dazu gesammelt und bin deshalb jetzt auch auf Ihre Seite gestoßen. Meine Freundin ist jetzt fast am Ende der Einnahme (noch 4 Tage) aber ihre Symptome sind seit zwei Tagen eher schlimmer geworden. Sie ist sehr schwach und hat jetzt Rückenschmerzen im unteren Lendenwirbelbereich was sie vorher nicht hatte. Wir sind jetzt verunsichert weil wir nicht wissen ob das ein normaler Teil der Behandlung ist oder ob die Borrelien sich in die Gelenke zurückziehen. Ich kann mir gut vorstellen was die Ärzte ihr verordnen, sollte die Behandlung nicht anschlagen – mehr Antibiotika über eine längere Zeit. Wo ich kein Freund von bin.Ihr derzeitiger Neurologe ist auch von Borreliose nicht überzeugt (er hält auch Rheuma für möglich) und hört ihr auch nicht wirklich zu. Von emotionaler Beruhigung ganz zu schweigen. Was würden Sie uns in dieser Situation raten?Vielen Dank
- Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 11.01.2021Lieber David,
solche Krankheitsgeschichten höre ich oft in meiner Praxis. Auch wenn die Gesamtsituation im Moment schwierig und undurchsichtig scheint, so ist es positiv, dass bisher alle Untersuchungen ohne Befund waren. Das stellt sicher, dass keine organischen Schäden vorhanden sind, sondern sich das Beschwerdebild im regulativen Bereich findet. Die wechselnden Beschwerden sind typisch für eine Parasitierung. Da es außer Borrelien ungefähr weitere 200 Parasiten gibt, kann das oft nicht genauer eingegrenzt werden. Das spielt für eine erfolgreiche Therapie zum Glück keine entscheidende Rolle, da pflanzliche Parasitenjäger meist ein weites Wirkungsspektrum haben. Oft ist auch Vitalstoffmangel (mit) ein Grund für die Regulationsstörung. Der Vitalstoffmangel ist meist mitbegründet in der Darmdysbiose, die sich durch die Antibiose vermutlich noch verstärkt hat.
Wie Sie merken, bedingt sich Vieles in der Folge und kann auch nur so erfolgreich behandelt werden. In der schulmedizinischen monokausalen Betrachtungsweise findet sich für solche Beschwerdebilder meist kein Ansatz, da innerhalb der medizinischen Disziplinen keine ausreichende Verknüpfung und vor allem Kopplung gewährleitet ist. Ich kann Ihnen daher nur empfehlen, sich einen GANZHEITLICHEN naturheilkundlichen Therapeuten zu suchen, der sowohl das Immunsystem, die Vitalstoffversorgung, die Darmgesundheit und die Parasiten im biologischen System gemeinsam und in Abhängigkeit voneinander betrachtet.
Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage. Lesen Sie meinen Therapieplan für die ganzheitliche erfolgreiche Borreliosebehandlung. Ich denke, dort werden Sie sich wenigstens teilweise wiederfinden.
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler
- Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 14.09.2020Liebe Anja,
ja so was kann vorkommen. Das ist im Moment kein Grund zur Sorge. Es zeigt nur, dass das Immunsystem aktiv ist. Am effektivsten hat sich bei mir in der Praxis das Produkt „Ery-mi“ herauskristallisiert, das mehrmals täglich auf die betreffenden Stellen aufgetragen wird. Falls es zu Hautirritationen kommen sollte, ist das Produkt „Erymi-ol“ zwischendurch anzuwenden. Das wirkt in die gleiche Richtung, ist jedoch auf Olivenöl-Basis und pflegt die haut. Damit sollten sie alles in den Griff bekommen.
Falls sich noch Verhaltensänderungen oder gesundheitliche Änderungen ergeben sollten, wäre es sinnvoll, die Therapie auszudehnen. Aber erst dann.
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler- Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 20.12.2021Liebe Anja,
das verschwindende und dann wiederkehrende Erythema ist nichts Ungewöhnliches und ich stimme Ihnen zu, dass der Körper immer noch in der Auseinandersetzung mit dem Erreger ist. Folglich machen alle immunstimulierenden Maßnahmen Sinn. Angefangen mit frischer Luft, guter möglichst entspannter Atmosphäre, was im Moment wirklich eine Herausforderung ist. Die Kinder sind dem Stress selbst zwar nicht direkt ausgesetzt, spüren ihn aber sehr wohl bei den Eltern und im Umfeld.
Orthomolekular denken Sie bitte an Vit C und Zink, bitte frei von schädlichen Zusatzstoffen, z. B. das Präparat Acerola Zink, an Vitamin D ca 2.000 i.E. tgl, für das Kind bevorzugt in MTC Öl, gerne auch Selen, Vitamin B3, B6 und B12 oder ein Vit.-B-komplex-Präparat.
Phytotherapeutisch können sie äußerlich auf das Erythema das Produkt Ery-mi auftragen. Es ist auf DMSO-Basis, folglich alkoholfrei und wird über die unverletzte Haut aufgenommen und wirkt daher auch sytemisch antiparasitär.
Eine abwechslungsreiche Ernährung mit viel Obst, aber frei von Kuhmilchprodukten und Hülsenfrüchten, runden die immunstimmulierenden Maßnahmen ab.
Mit den besten Wünschen für Ihre Tochter,
Ihr Dieter Berweiler - Anja, am 19.12.2021Sehr geehrter Herr Berweiler,
das Erythema bei meiner 4-jährigen Tochter bleibt für ein paar Monate sichtbar, dann verschwindet es für ein paar Monate und dann ist es wieder sichtbar (wie in einem "Kreis"). Dem Kind geht es gut, für mich ist ein Zeichen, dass der Körper weiter kämpft. Sollte ich noch etwas berücksichtigen? Ich danke Ihnen sehr!
- Anja, am 12.09.2020Sehr geehrter Herr Berweiler, meine Tochter (3J) hatte im Juni eine Zecke am Arm. Bis vor paar Tagen war an dem Arm nichts zu sehen, jetzt hat sie eine Wanderröte. Keine weitere Symptome. Was würden Sie in ihrem Fall empfehlen? Würde wilde Karde ihr helfen?Ich danke Ihnen sehr!
- Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 29.07.2020Liebe Frau Kirschner,
Karde kann problemlos auch während der Schwangerschaft eingenommen werden, ist sie sogleich auch fruchtschützend. Auch beim Stillen bringt sie dem Säugling Vorteile, der davon über die Muttermilch partizipiert. Einen Abstand halten ist therapeutisch nicht notwendig, finden sich die Pflanzeninhaltstoffe nach der Resorption im Darm oder Mundschleimhaut in ihrer Blutbahn. Auch die weiteren Produkte, die ich in der Borreliosetherapie empfehle sind für stillende Mütter und den Säugling nur vorteilhaft ohne jegliche Nebenwirkungen im schulmedizinischen Sinne. Ob Borrelien über das Stillen übertragen werden können, ist nicht belegt. Im Moment gehen wir davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Allerdings werden Borrelien Antikörper sehr wohl über die Muttermilch von der Mutter an den Säugling weitergegeben. Ein eventueller Borrelien Antikörpertest (die normale Bluttestung) kann somit auch beim Säugling positiv sein, sofern das Immunsystem der Mutter Antikörper gebildet hat. Eine Aussage abgeleitet von der Höhe der Antikörper auf die Höhe der Borrelien lässt sich dadurch jedoch nicht ableiten.
Für weitere Informationen lesen sie einfach meinen im Internet auf meiner Homepage frei zugänglichen Therapieplan zur naturheilkundlichen, ganzheitlichen Borreliosebehandlung. Dort finden sie viele Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler - Sarah Kirschner, am 29.07.2020Sehr geehrter Herr Berweiler,
kann man die Karde auch nehmen, wenn man noch Stillt? Oder sollte man zumindest ein paar stunden Abstand halten zur Einnahme der Karde? Und wie sieht das bei den anderen Sachen aus, die Sie zur Behandlung der Borreliose empfehlen? Gibt es bei stillenden Frauen etwas zu Beachten in Bezug auf Borreliose und Borreliose-Behandlung? Kann die Borreliose auf das Kind übergehen durch Stillen?
Vielen herzlichen Dank!
Sarah Kirschner - Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 22.06.2020Hallo Adriana,
solche Krankheitsgeschichten höre ich regelmäßig in meiner Praxis. Aber erstmal vorneweg. Wenn es nur noch 2 Tbl. Doxycyclin sind, macht es Sinn, diese noch zu nehmen. Ob der Fleck von Borrelien kommt oder von anderen Parasiten wie Babesien, Bartonella oder Rickettsien, lässt sich mit dem Blutbild nur bedingt diagnostizieren, sofern es überhaupt untersucht wurde, was in Ihrem Fall leider nicht passiert ist. Es kann auch ganz andere Ursachen haben. Ihr Beschwerdbild hängt aber definitiv zusammen mit einem Vitalstoffmangel, mitverursacht von einer Darmdysbiose. Vermutlich ist Ihre Ernährung nicht ganz so toll, wie Sie es im Moment glauben. Das hat nun zur Folge, dass das Immunsystem, welches zu 80 % im Darm verankert ist, ebenfalls gestört ist. Dazu kommt jetzt die Antibiose, die die Sache im Grunde eher weiter verschlechtert.
Zusammengefasst kann ich Ihnen sagen, dass ich viele Patienten wie Sie bereits zur Gesundheut begleitet habe. Aber es ist eine Veränderung notwendig, wenn nicht sogar ein Umkrempeln von den Sie krank machenden Ursachen, die Ihnen höchstwahrscheinlich nicht bewusst sind. Wenn Sie dazu bereit sind, steht dem Weg Richtung Gesundheit nichts im Wege. Sie können sich jetzt schonmal auf meiner Homepage schlau machen. Da bekommen Sie einen groben Überblick, was alles gemacht werden sollte. Diese Basistherapie wird meist durch individuelle Therapien für den einzelnen Patienten ergänzt.
Mit den besten Kräutergrüßen
Dieter Berweiler - Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 22.06.2020Lieber Oliver,
das ist eine sehr umfassende Frage, da Ihre MS vermutlich mitverursacht wird von den Rickettien. Es gibt durchaus erfolgsversprechende Möglichkeiten, die sowohl Borrelien als auch den Rickettien naturheilkundlich zu begegnen. Gleichzeitig sollte aber was zur Verbesserung der MS gemacht werden. Ja, das ist möglich, aber sehr komplex und langwierig. Wenn Sie sich auf das Abenteuer einlassen wollen, freue ich mich auf Sie.
Mit besten Kräutergrüßen
Ihr Dieter Berweiler - Adriana, am 18.06.2020Guten Tag,ich bin 60 Jahre alt und habe am Oberschenkel einen roten 3cm großen Hautfleck, keine Wanderröte besteht seid mind. 5 Monaten.Alle Elisa Tests 2x wiederholt negativ. Hauttest war nicht eindeutig, aber Verdacht 50% Borreliose. Seid 2016 Herzrhytmusstörungen 30,000 pro Tag. Starke Schmerzen in der Hand, Reizdram, Nahrungsmittelunvertrglichkeiten, Hystaminintolleranz, Starker Haarausfall kommend und gehens, Haarspitzen/Kopfhaut schmerzen, immer wiederkehrende Mandelentzündung, Rachenentzündung, Nachts starkes Schitzen, Frieren in der Sonne, Schmerzen in den Füßen, Schmerzen im Rücken KWS sollte schon operiert werden ging aber zu 100% zurück, Kurze immer wiederkehrende Nesselsucht, Tinnitus, starke Ohrgeräusche wie Metall, neuerdings Kurzzeitgedächtnisprobleme und der Hautfleck, mein Internist glaubt dem Blubild, eine Bedandlung mit Doxyicilin musst abgebrochen werden nach 2 Tabletten, extreme Nebenwirkungen, Magenschmerzen mit Erbrechen, Schüttelfrost, brennende Haut Nacht, Füße brennen, starkes KrankheitsgefühlNehme jetzt Karde Tinktur, Crapefuitkernelösung, Katzenkralle, Alliin, trinke mehr und achte auf meine Ernährung, kann mir das alleine Helfen?
- Oliver, am 10.06.2020Lieber Herr Berweiler,dank Ihnen für Ihre Ausführungen zu dem Thema Borrelien. Bei mir wurde aufgrund eines Borrelienverdachts Rickettien im Blutplasma gefunden. Haben Sie diesbezüglich Erfahrungen gesammelt und eine Idee diesen zu begegnen? Vor 25 Jahren wurde aufgrunddessen bei mir MS diagnostiziert und mich therapeutisch entsprechend behandelt.Dank Ihnen für Ihre Antwort.Viele GrüßeOliver
- Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 04.05.2020Antwort auf die Frage von Alexander vom 2.5.2020
Hallo Alexander,
in meiner Therapie zur naturheilkundlichen Borreliosebehandlung hat Vit. D seinen festen Stellenwert und ich verordne zwischen 10.000 und 20.000 i.E. täglich - je nach Blutwert.
Kefir kann sehr gut aus Schafsmilch und die Budwig Diät mit Schafsquark bereitet werden. Damit kommt es zu keinen “Kollisionen“.
Liebe Grüße
Dieter Berweiler - Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 04.05.2020Antwort an die Frage von Nelli vom 26.04.2020
Liebe Nelli,
die Allergie ist ein eindeutiges Zeichen für ein gestörtes Immunsystem. Das gestörte Immunsystem ist die Eintrittspforte für Parasiten jeglicher Art. Daher hat Ihr Sohn ein erhöhtes Risiko, an einer parasitären Erkrankung zu erkranken. Das soll aber nicht gleichzeitig bedeuten, dass dies jetzt der Fall ist, vermutlich eher nein.
In der aktuellen Situation mit der Wanderröte würde ich bei meinem Kind erstmals nichts machen. Für mich zeigt das Kommen und Gehen der Wanderröte, dass das Immunsystem noch aktiv ist. Das ist also ein gutes Zeichen.
Im Moment am schnellsten, einfachsten und wichtigsten ist die Ernährung auf "artgerecht" umzustellen. Fordern sie dazu meine aktuelle Ernährungsrichtline im Praxisbüro an und halten Sie diese kompromisslos ein.
Als zweiten Schritt gilt es bei Ihrem Sohn die Allergie naturheilkundlich zu behandeln. Dann ist es nur noch ein sehr kleiner Schritt, diese Therapie um den parasitären Teil zu ergänzen.
Leider kann ich Ihnen keinen Therapeuten in Nürnberg empfehlen, da bisher kein Therapeut im Nürnberger Raum meine Theraspie ganzumfänglich übernommen hat.
Sie können aber gerne mal bei Frau Dr. med. Charlotte Steiner nachfragen, ob sie Ihren Sohn nach meinem Therapieplan behandeln möchte. Ansonsten begrüße ich Sie gerne in meiner Praxis. In der derzeitigen Situation mache ich auch viele Ersttermine per Skype.
Ich möchte noch anmerken, dass eine eventuell vorhandene Borreliose speziell bei Kindern aus therapeutischer Sicht meist einfach naturheilkundlich erfolgreich behandelbar ist.
Liebe Grüße
Dieter Berweiler - Alexander, am 02.05.2020Lieber Herr Berweiler,
inzwischen folge ich einem Großteil ihres Therapieplanes:
das Borreliose-Quartett und die Darmsanierung mittels Hypo A von der Urdrogerie
Meine Frage betrifft Vitamin D und die Wirkung auf das Immunsystem.
Was ist ihre Erfahrung bei Borreliose Patienten und der Einnahme von Vitamin D hochdosiert? (dazu Mg)
Selbstverständlich erst nach Messung des Vitamin D und Calzium Spiegels.
Inzwischen ist Vit. D in aller Munde, außer bei vielen Ärzten. Ich selbst hatte einen Wert von nur 12 und einen Mangel wohl über Jahre.. Manche Befürworter sagen, es brauche einen Spiehel von 50 - 80, so dass alles wieder in Schwung kommt vor allem das Immunssystem durch Vit. D.
2. Frage: gesundes Bio-Kefir für den Darm oder die bekannte Bio Budwig Creme (mit Leinöl) -
ist das Ihrer Ansicht auch Tabu wie alle anderen Milchprodukte?
Ich freue mich auf Ihre Antwort und danke Ihnen vielmals!
Beste Grüße aus Neu-Ulm
Alexander - Nelli, am 28.04.2020Sehr geehrter Herr Berweiler, auf der Suche nach einer Antwort bin ich auf diese Seite gestoßen. Es geht um meinen 4 jährigen Sohn. Abgesehen davon, dass er starker Allergiker ist, was wir gut unter Kontrolle haben, geht es um eine „wanderröte“. Mir ist vor kurzem ein Ring an seinem Nacken aufgefallen. Am nächsten Tag war er weg. Ein Tag später erneut aufgetreten, jedoch viel großflächiger bis zur Wange. Bin direkt zum Arzt. Dort stellten wir an mehreren Stellen am Körper solche Ringe fest. Es wurde Blut abgenommen um auf Borrelien zu testen.
Am nächsten Tag war es wieder weg. Das Ergebnis ergab leicht erhöhte Antikörper, worauf er zwei Wochen AB einnehmen soll, die ich ihm jedoch nicht gegeben habe. Dann kam der Ring wieder am Rücken! Einige Tage später wieder weg. Nun ist seit einigen Tagen der ursprüngliche Ring am Nacken da. Er hatte dieses Jahr keinen Zeckenbiss. Die Jahre zuvor schon.
Ich verstehe das ganze überhaupt nicht. Er steckt momentan in seiner Birkenpollernallergie. Kann das auch eine Reaktion darauf sein? Bin ratlos. Ich würde, falls es nötig ist, sogar in ihre Praxis kommen. Wir wohnen bei Nürnberg. Sie können mir auch gerne jemanden in der Nähe empfehlen.
Wir haben so viel mit ihm durch gemacht! Ich wünsche ihm wirklich, dass es keine Borrelien sind ...
Wenn sie mir vielleicht antworten können, wäre ich ihnen sehr verbunden! Ich weiß einfach nicht, an wen ich mich wenden soll, da wir schon etliche Ärzte und Krankenhäuser durch haben und meine Meinung von Medizinern gleich null ist ...
Ganz liebe Grüße aus Oberasbach - Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 02.03.2020Hallo Herbert,
es kommt nicht darauf an, alle Borrelien loszuwerden bzw. zu vergiften. Es kommt darauf an, dass sie durch das intakte Immunsystem so gut in Schach gehalten werden, dass sie gesundheitlich keine Rolle spielen. Ein intaktes Immunsystem lässt keine Parasitierung zu, davon bin ich fest überzeugt und das spiegelt sich auch in meiner Praxis wider. Ein Wohlbefinden ist der einzige Anhaltspunkt und nicht ein Stück Papier, auf dem eine meist falsch interpretierte Zahl steht. Lesen sie dazu bitte meine Beurteilung der Antikörpertests und dessen Zuverlässigkeit. Bitte verwechseln sie diese Tests auf keinen Fäll mit einem Borrelientest. Es werden Antikörper getestet, also eine Reaktion des Körpers auf einen Erreger und nicht der Erreger selbst. Die unterstellte Korrelation zwischen Erregeranzahl und Antikörper ist reine Fantasie und lässt sich in der Praxis in keinster Weise erkennen, nicht mal ansatzweise.
Karde komplex 2 x 3 Tpf ist eine angemessene Dosierung, gerne in Verbindung mit L/Ni komplex 2 x 4 Tpf, Braunwurz komplex 2 x 4 Tpf und Mercuridon 2 x 2 Tpf, um das Borreliosequartett komplett zu machen. Bitte vergessen sie die Substutition der Vitamine nicht.
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler - Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 02.03.2020Hallo Alexander,
ja ich kenne Rizol Zeta und ich habe bei Dr. Steidl auch eine Weiterbildung gemacht. Ich selbst arbeite allerdings nicht damit. Das Wirkprinzip von Rizol zeta ist die Sauerstoffabgabe, wenn das Olivenöl sich vom Rizinusöl wieder trenntn verbunden mit den beigefügten ätherischen Ölen. Das gleiche Wirkprinzip der Sauerstoffabgabe hat auch DMSO, wenn aus Dimethylsulfoxid unter Abgabe eines Sauerstoffs Dimethylsulfid wird. Mit DMSO habe ich sehr viel Erfahrung, verstärkt es gleichzeitig alle dazugegebenen Präparate. Ohne eine Leber und Nierenstärkung würde ich keine Therapie empfehlen. Karde und Co ist nach meinen Erfahrungen unverzichtbar, da die Kombination aus Karde und einjährigem Beifuß nachhaltig die Borrelien eliminiert. Ebenso ist Braunwurz & Co für die Reinigung der Lymphe unumgänglich. Das A und O einer jeglichen parasitären Therapie ist die Milieusanierung. Wie schon Pettenkofer sagte: „Der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles“. Aber genau das wird von den meisten Menschen nicht hinreichend berücksichtigt während der Therapie und vor allem auch danach. Die innere Körperpflege gehört genauso selbstverständlich in den täglichen morgendlichen bzw. abendlichen Hygienezyklus dazu wie das Zähneputzen. Deswegen ist meine Therapieempfehlung auch so umfassend geworden. In dieser Therapieempfehlung (s Therapieplan für die GANZHEITLICHE naturheilkundliche Borreliosetherapie) habe ich versucht, alle wesentlichen Punkte zusammenzufassen. Das ist deutlich mehr als Rizol oder Karde & Co sondern ein Blumenstrauß voll Maßnahmen, der alle Regelkreisläufe im Körper berücksichtigt.
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler - Herbert, am 02.03.2020Sehr geehrter Herr Berweiler, ich habe mich vor Jahren angesteckt. Der Hautarzt verordnete vor 1 Jahr eine Antibiotika-Kur (4 Wochen), dann testete er monatlich, halbjährlich und jährlich. Er erklärte, daß das Ergebnis nach 1 halben Jahr so war, daß er beinahe eine weitere Kur verordnet hätte. Ich will die Tierchen loswerden. Aus anderem Grund habe ich eine Ernährungsumstellung vorgenommen (keine Kuhmilch, kein Fleisch außer Fisch und Geflügel, viel Gemüse, Obst, nur Roggenbrot usw.).
Ich habe nun den Karde-Komplex (DMSO) bekommen. Sind 3x2 Tropfen täglich angemessen?
So, wie man den Erfolg der Antibiotika-Kur nicht feststellen kann, so steht es auch für Ihr Vorgehen. Gibt es Anhaltspunkte dafür, daß man die Borroliose losgeworden ist? - Alexander, am 29.02.2020Hallo Herr Berweiler,
erstmal herzlichen Dank für Ihre zahlreichen hilfreichen Informationen!
Mein Frage ist:
Haben Sie Erfahrungen mit Rizol Zeta nach Dr. Steidl mit oder ohne DMSO gemacht?
Diese Ozonie sind auch in aller Munde und sind vielversprechend bei der Borreliose Behandlung.
Sollte dann auch unbedingt Niere/ Leber gestärkt werden, wenn man so eine Therapie macht?
Und Karde & Co wäre wohl schon eine sehr sinnvolle Ergänzung?!
Danke für Ihre Antwort!
Lieben Gruß
Alexander - Dieter Berweiler aus Stuttgart-Mühlhausen, am 29.01.2020Lieber Herbert,
ein Präparat für eine erfolgreiche Behandlung der Borreliose bedarf meiner Erfahrung nach etlicher Zutaten wie Karde, Artemisia annua, Kapuzinerkresse, Gelber Salbei, Eselsdistel sowie Jiaogulan.
Für die parallel sinnvolle Stützung von Leber und Niere wären eine Mischung aus den Kräutern Mariendistel, Goldrute, Hauhechel, Brennnessel, Glaskraut, Ringelblume Bärlauch und Dong Ling Cao förderlich.- Gestützt mit einer phytotherapeutischen Schwermetallausleitung mit Cistus, Walnuss und Katzengamander.
Bereits fertige Mischungen mit jahrelanger Anwendererfahrung dieser Kräuterkombinationen finden Sie in der Urdrogerie.
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler, Heilpraktiker - Herbert, am 28.01.2020Der Text zur Borroliose ist sehr lesenswert. Man hätte gerne genaueres gewußt. In welchem Verhältnis soll man die Karde und Artemisia annua komninieren, welche weiteren Bestandteile sind wie hinzuzufügen?
- Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 15.10.2019Liebe Marlene,
diese Geschichten höre ich oft – leider. Es ist auch so, dass viele Hausärzte eben nur Doxicyclin kennen, obwohl dadurch meiner Meinung nach eine Borreliose chronifiziert wird. Ob die Zecke bei Ihrer Tochter überhaupt Borrelien hatte, ist auch nicht geklärt. Ebenso wenig wie die häufig üblichen sogenannten Co-Erreger.
Ich würde meiner Tochter nicht Karde, sondern Lappania geben. Das erfasst auch eventuell „mitgelieferte“ Co-Erreger.
Starten sie mit 2 x 1 Tropfen täglich und steigern Sie alle 2 Wochen um einen weiteren Tropfen bis zu einer Höchstdosierung von 2 x 5 Tropfen. Damit sollten Sie die Erreger eliminieren können.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Berweiler - Marlene, am 13.10.2019Lieber Herr Berweiler, vor ca. 8 wochen wurde meine 4jährige Tochter am kopf von einer zecke gebissen. 3 Wochen später trat die wanderröte auf ihrer Wange auf. Sie bekam 10 Tage lang amoxycillin. 2 Wochen später litt sie für mehrere Tage an einem magen- darm Infekt (sie hat bislang noch nie Medikamente bekommen und war in ihren jungen Jahren nur einmal krank). In dieser Zeit, also vor zwei Tagen, sprach sie auch davon, dass ihr manchmal der Rücken, besonders die wirbelsäule, schmerzt. Heut hat sie mir mitgeteilt, dass sie bißstelle oft juckt und ich finde, dass diese ein wenig angeschwollen ist.Kann ich ihr für die nächsten wochen/Monate eine karde tinktur (natürkich ohne alkohol) verabreichen? Ich wünschte so sehr, ich hätte die zecke eher bemerkt.Ich freue mich sehr auf ihre Antwort. Viele liebe Grüße, marlene
- Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 02.10.2019Lieber Volker,
mit dem Begriff BIOFILM bei Borrelien ist eine Schutzhülle um die Borrelien herum gemeint, damit diese von der körpereigenen Abwehr nicht attackiert werden können. Man könnte auch zum besseren Verständnis „Stadtmauer“ sagen.
Zu der Frage, ob der Konsum von Ölen in irgendeinem Zusammenhang mit dem Biofilm steht: Darauf gibt es keinerlei Hinweise.
Ich wünsche Ihnen auf Ihrem Gesundungsweg noch alles Gute.
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler - Volker, am 02.10.2019Korrektur.(zu Kommentar 27.09.2019 von mir)
Ich meinte (obgleich beide essbar) nicht Morcheln sondern Austern Pilze.(Kultur nicht ungesündere Wildpilze)Aber nur gelegentlich. Zu vernachlässigen.
Die Wundrose oder Wanderröte ist die letzten 3 Tage unerwartet noch nicht wieder durchgekommen. Sicherheitshalber hatte ich das Bein jeden Tag morgens und abends mit naturtrüben Bio-Apfelessig eingerieben und tw mit Rotlichtlampe getrocknet. Die Karde scheint jetzt vielleicht zu wirken. Ich hatte anfangs den Eindruck das das Brenngefühl-hier und da im Körper, vorrübergehend- stärker war. Es kann natürlich Rückschläge geben, derzeit sieht es aber -vorsichtig- nach Besserung aus. Vielleicht habe ich Glück und es läuft unerwartet gut. Vielleicht auch weil ich kein Antibiotikum nahm. Weil ich habe mal gehört das Homöopathische Mittel(z.B. wenn zuvor Cortison...genommen) nicht wirken. Leider habe ich auch wurzelbehandelte Zähne, was ich im Auge behalten muss.(Heilerde nehme ich auch etwas.)
Mit freundlichen Grüßen
Volker
Woher der Biofilm kommt in dem sich die Boreolen verstecken weiß ich immer noch nicht, oder was den begünstigt. - Volker, am 27.09.2019Sehr geehrter Herr Berweiler,Nachdem ich mich durch den Wissensdschungel einigermaßen durchgelesen habe,und erst einmal angefangen habe mit dem was ich hin bekomme, obgleich alles TW praktisch, TW zeitlich nicht geht, und für manche unlösbare Probleme wie Trinkmenge von 3 Liter am Tag einiger Maßen eine Lösung gefunden habe (Nachts dazu trinken). Habe ich erst einmal mit 4 Tage Fasten begonnen. Danach nehme ich dann wenn ich wieder esse Die Karde. Weil ich Alkohol, erst recht unverdünnt in der Vergangenheit auf Magen geht was ich früher bei Toxi Loges usw merkte, oft nicht vertrage. Da jetzt die Blütezeit vorbei geht, vermute ich einmal das Pollen ganz gut sind da sie Vitamin B bringen. Und außerhalb der Blütezeit keine Allergie auslösen.Ich habe die Antibiotikatabletten von der Ärztin nicht genommen. Eben wegen der Darmfolra die ich mir Normalisiert habe. OK würde ich anorganischen Schwefel nehmen würde es noch riechen so 100% war es nach ca. 1 Jahr damit noch nicht. Aber vermutlich gut wenn auch nicht sehr gut.Wenn das Antibiotika Intravenös statt in Pillen verordnert worden wäre hätte ich noch einmal drüber nachgedacht, aber das wird scheinbar normalerweise schulmedizinisch nicht gemacht, vermutlich zu teuer. Dann habe ich mir einen Heilpraktiker gesucht. (Der zuerst wollte das ich zum Arzt gehe. Und erst danach zu ihm. Was mich auch etwas verwirrte.) Dann bin ich (Die Entzündungshemmende SAlbe von Ärztin nahm ich noch, die nicht ausreichte, die Pillen nicht mehr.) Mit der eigentlichen Behandlung mit Umschläge aus Rivanol Lösung 0,1% angefangen. Das war sehr gut wirksam innerhalb von 2 Tagen ging die Wundrose stark zurück. Das Problem ist nur das ich dann auch drüber und drunter abwickeln muste mit Befeuchteten Tuch, Frischalte Folie und Bandage drüber um es zu halten. Aber eigentlich nimmt die Bahandlung kein Ende weil inzwischen am Oberschenkel angelangt es sich nicht wirklich abdecken lässt da beim Gehen verrutscht. Und insbesondere am Knie nach einem Tag ohne Wickel sich erste Dunkle Punkte zeigen das die Boreolose aus der Tiefe scheinbar wieder hoch kommt. Das Rivanol wirkt ja soweit ich weiß nur oberflächlich, da aber ERST EINMAL ganz gut.Allerdings mit dem Wickel geht Sauna nicht. Ob die kleine Rotlichtlampe wie lange anzuwenden was bringen würde?Jogging wäre gut. Nur geht nicht weil linker Fuß Schleimbeutel Entzündung nicht weg geht. Ursache war das unbemerkt das Sprunkgelenk raus war. Hat Heilpraktiker wieder eingerenkt. Aber Jogging würde wieder Schwellung fördern. Ich hoffe das das Fasten da auch etwas hilft.Wenn ich nicht Faste nehme ich auch Lurgische Lösung 1 Tropfen am Tag also Jod. Etwas verunsichert hat mich das mit den Biofilmen. Es ist ja nicht ganz einfach bei all den Einschränkungen noch eine passende Ernährung zusammen zu stellen. Wegen der Milchsäure Bakterien gehört bei mir rohes Sauerkraut dazu. Ich versuche Sauerteig mit Hafer zu ergänzen. TW Morcheln...Eigelb... Nur ich versuche mich stark von Cocosöl und frisch gepresstes Leinöl und Natives Olivenöl zu ernähren (Und damit es schmeckt Banane Kakao unterzumischen)FRAGE: Fördern diese Öle den Biofilm der Boreolen unter dem die sich verstecken? Oder hat das gar nichts damit zu tun? Freundliche GrüßeVolker
PS.
Ich hatte zwischendurch eine einseitige Mandelentzündung wogegen ich nichts machte und der Körper steigerte die Temperatur von ca. 36°C auf Kurz 37,2 °C und nach 1-2 Tage wars weg. Schade das der Körper kein Fieber macht, vielleicht wäre die Boreolose dann auch weg. - Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 06.09.2019Antwort zum Kommentar von Jo vom 2.9.2019
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie haben hier meine Ausführungen gelesen und ich hoffe, sie konnten dadurch ihr Wissen vertiefen. Weitere Informationen von mir erhalten Sie in meinem Youtube Kanal https://www.youtube.com/channel/UCZ2y7vM9NwwsHGuvZRCKHmg
und auf meiner Homepage https://www.dieter-berweiler.de/therapieplaene/therapieplan-fuer-die-erfolgreiche-naturheilkundliche-borreliose-behandlung/1-allgemeines.html
Ich hoffe Sie finden alle relevanten Informationen. Falls danach noch Fragen offen sind, können sie gerne einen Beratungstermin bei einem Therapeuten Ihres Vertrauens vereinbaren, um den Sachverhalt genauer zu beleuchten.
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler - Online-Redaktion, am 03.09.2019Liebe Anna,
vmtl. wurde bei Ihnen der Punkt hinter PDF mit in den Link mit einbezogen. Wenn man diesen entfernt, funktioniert der Link.
http://www.dieter-berweiler.de/fileadmin/pdfs/HP/Therapieplan_Borreliose.pdf
Viel Erfolg wünscht Ihnen
Ihre Online-Redaktion - Anna, am 03.09.2019Sehr geehrter Herr Berweiler,
würden Sie mir bitte Ihren Therapieplan per Mail als Datei zukommen lassen, da der angegebene Link nicht funktioniert, das wäre sehr freundlich.
Herzlichen Dank und liebe Grüße! Anna - jo, am 02.09.2019Hallo,Mein Vater ist seit über 25 Jahren an Borreliose erkrankt. Richtig mitbekommen habe ich es als ich in der Grundschule war. Er hatte Muskelkrämpfe und starke Schmerzen, während der Krampfanfälle durfte ich nicht zu ihm. Er sollte in die Psychiatie, wurde als Schauspieler abgetan. Mein Großvater konnte das verhindern. Er hat die Selbstständigkeit aufgeben müssen, meine Mutter ihre Arbeit um sich um ihn zu kümmern. Die nächsten sieben Jahre haben wir von Sozialhilfe gelebt. Die Ehe meiner Eltern ging unter den Umständen über viele Jahre immer mehr in die Brüche. Dinge die nichts miteinander zu tun hatten, wurden unentwirrbar vermischt, für uns Kinder zu keinem Zeitpunkt verständlich gemacht. Mein zuvor erwähnter Großvater, der Arzt ist und nachgewiesen unter Realitätsverlust litt, therapiert mein Vater seit er den Gang in die Psychiatrie verhindern konnte. Eine nicht nur für mich fragwürdige Therapie, nämlich mit hochdosierten Meroneminfusionen, die oft sehr starke postantibiotische Reaktionen verursachen. Mein Vater ist nicht dumm und weiß um andere Behandlungsansätze (Hyperthermie, Basenbäder, Darmsanierung, Kardentinktur etc), doch bin ich mir sicher dass auch er unter einer dissoziativen Identitätsstörung leidet. Er ist seit ich mich erinnern kann, immer mehr in seine geistliche Welt abgetaucht, in der für mich absolute Wahrheit und großer Irrtum ganz nah beieinander liegen. In meiner Welt hat sich so die Borreliose als Symbol für alles unaufhaltsam schlechte etabliert. Vor circa einem Monat habe ich auf Wunsch meines Vaters und Großvaters einen große Laboruntersuchung gemacht mit unklarer Diagnose. Meine Blutkörper waren auf jeden Fall schon mit Borrelien in Kontakt heißt es. Hintergrund der Untersuchung ist, dass ich vor circa drei Jahren das Pfeiffersche Drüsenfieber hatte und seit dem nicht mehr wirklich in der Lage bin regelmäßig Sport zu treiben, geschweige denn Leistungssport wie es vorher der Fall war.Wie man sich denken kann, bin ich jetzt mit der Situation total überfordert.Ich will mich nicht an die Falschen Leute wenden weil ich die typischen Reaktionen schon kenne - auch von Ärzten. Versuche es jetzt mit Basenbädern, wilder Karde, viel Wasser und richtiger Ernährung, obwohl ich diese Borreliosespezifisch noch nicht richtig verstanden habe.Bitte um Hilfe/ Rat/ Verständnis
- Dieter Berweiler, Heilpraktiker aus Stuttgart-Mühlhausen, am 27.08.2019Sehr geehrter Volker,
Fabrikzucker sollte grundsätzlich gemieden (0 %) und durch Rohrohzucker ersetzt werden (alter Hut J). Wir essen generell zu viel davon, also die Menge von Rohrrohzucker stark reduzieren.
Die homöopathischen Kügelchen sind meist aus Laktose, das grundsätzlich nicht gespalten werden kann und im Darm vergärt wird und dadurch die Verdauung massiv stört. Kügelchen aus z. B. Saccharose als ergänzende Therapie machen im Einzelfall Sinn.
Zur Homöopathie ist zu sagen, dass sie eine Regulationsoptimierung ist und bei Borreliose als Milieuerkrankung nur ergänzend Sinn macht. Stevia arbeitet im Vergiftungsprinzip und wird daher Borrelien nicht 100%ig eliminieren. Ich lehne sie deswegen als nicht nachhaltig zielführend ab. Vit.-B-Mangel bzw. Vitalstoffmangel ist ein grundsätzliches Problem, da dadurch die Rekonvaleszenz deutlich verzögert bis verhindert wird. Gemeint ist nicht nur das Vit B12 sondern wirklich alle B-Vitamine, insbesondere Vit B2 und Vit B3, aber auch z. B. Selen, Zink und Glutathion. Bei Tinkturen ist es relevant, dass sie durch die Mundschleimhaut resorbiert werden und nicht durch Verdünnen in den meist gestörten Darm kommen, wo die Resorption nicht mehr sicher gewährleistet ist.
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler - Volker, am 26.08.2019Sehr geehrter Herr Berweiler,
mir ist da etwas eingefallen das ich schon vergessen hatte. Es könnte (Vermutung Laie) aber vielleicht mit Blick auf Boreolose sehr wichtig zu wissen sein. Vielleicht entscheidend.
Ich habe in einem alten Buch von Dr.M.O. Bruker einmal gelesen (Im Buch im Zusammenhang mit Kinderlähmung, und der Vermeidung von Speiseeis Fabrikzucker, in einer Stadt in den USA in Zusammenarbeit mit einer Regionalzeitung.) Das weitgehend unbekannt der Körper über ein zusätzliches Verteidigungssystem verfügt, das bei den meisten Menschen nicht genutzt wird.Dabei verfügt der Körper von Natur aus über die Fähigkeit Fremdkörper außer mit Abwehrzellen über eine Art Tür System abzuwehren. Der Körper schließt im Körper Türen die das Vordringen der Angreifer Stoppt. Aber wehe dem der Fabrikzucker isst (Keine Ahnung ob auch bei Auszugsmehl). Denn das verursacht schon bei kleinsten Mengen (Genaue Dosis ?) den Ausfall dieses Verteidigungssystems. Vermutlich durch Vitamin B...Mangel.
Ich vermute, wer Boreolose hat sollte strengstens auch jeden Krümel Fabrikzucker meiden. (Lieber einen Apfel essen.)
Wenn ich es richtig verstanden habe soll die Karde auch helfen den Boreolose Erreger auszusperren. Das wären dann zwei verschiedene Ansätze mit ähnlichem Ziel.
Ich frage mich dann aber bei den (Variante) homöopatischen Mittelchen mit Zuckerkügelchen Ob die bei Boreolose ein Fehlgriff sind.
MIt Stevia gibt es vermutlich noch keine Homöopathische Kügelchen ?
Keine Ahnung ob das ein Apotheker machen kann. Verkaufen ja meistens Fertigprodukte.
Bei der Alkoholischen Variante, würde ich verdünnen wollen, nur obs dann noch wirkt? Karde soll ja pur genommen werden.
Vielleicht habe ich den Therapieansatz damit erweitert.
Oder ein alter Hut. Nur habe ich noch nirgendwo etwas davon gelesen. Und die Veröffentlichungen von dem Wissenschaftler (Kinderlähmung USA...1950 /60er Jahre) hatten damals auch Niemanden interessiert. War ja nichts zur Steigerung von Konzernumsätzen.
Mit den besten optimistischsten Grüßen
Volker Jäger - Dieter Berweiler aus Stuttgart-Mühlhausen, am 20.08.2019Lieber Volker,
so wie ihnen geht es vielen Betroffenen. Eine Borrelieninfektion ist erstmals nichts Schlimmes. Wichtig ist, was sich daraus entwickelt. Ein intaktes Immunsystem regelt das oft. In den Fällen, wenn der Körper Unterstützung braucht, ist eine ganzheitliche Therapie angesagt. Lesen sie dazu einfach auch meinen Therapieplan: https://www.dieter-berweiler.de/therapieplaene/therapieplan-fuer-die-erfolgreiche-naturheilkundliche-borreliose-behandlung/1-allgemeines.html. Mit diesem Wissen können sie dann eine für sie gute Entscheidung treffen. Falls sie sich wie viele Andere überfordert fühlen, holen sie sich bei einem erfahrenen Therapeuten Hilfe für eine GANZHEITLICHE Therapie. Was da alles dazu gehört, haben sie dem Artikel entnommen. So können sie auch beurteilen, wie gut das ihnen Angebotene ist.
Liebe Grüße
Dieter Berweiler - Volker, am 16.08.2019Hallo liebes Naturheil Team,ich finde diese Internetseite auf die ich gerade zufällig gestoßen bin sehr gut. Man findet hier leider auch kein Patentrezept, aber man kann sich und die Situation in der man sich befindet durch Vortrag und Kommentar -wie ich vermute- besser einschätzen.Bei mir persönlich (52 Jahre) ist es so das ich eines Morgens mit einem unangenehmen vorrübergehenden Gefühl am rechten Unterschenkel aufwachte. Er war unterm Knie in etwas punktuell gerötet. Ich dachte mir Zipperlein kommt Zipperlein geht und hab mich 1,5 Monate nicht weiter drum gekümmert. Ich dachte sogar die Abschwächung der Röte dafür nach Unten Ausbreitung als beginnende Auflösung deuten zu können. Als dann aber der ganze Unterschenkel leicht gerötet war und blieb, fürchtete ich aber doch ein Problem. Im Internet stand Wanderröte,Ärztin sagte Boriolose. Da ich seit Jahren darauf achtete kein Antiobitika zu nehmen und meine Darmbakterien zu optimieren, mit Schwerpunkt Pflanzliche Rohkost wie Sauerkraut mit Creme Fraiche 30% Fett. Inzwischen mehr Haferbrei und frisches selbstgepresstes Leinöl oder Bio Cocosöl mit Banane und Eigelb usw. Und Umkehrosmosegefiltertes Wasser. Wollte ich kein bereits im Internet angedrohtes Antibiotika. Da Nichts Tun aber offenbar auch nicht half und mir ein Übergreifen als Nächstes auf die Gelenke angekündigt wurde. Habe ich dann die Salbe (Diporgenta Eurimoharm CRE N2 50g)Die wohl ein Antibiotikum zu sein scheint doch genommen. Obs ausreicht weiß ich noch nicht. Die Laboruntersuchung ist auch noch offen. Aber soll ja nur die Diagnose absichern. Bei allem Suchen nach Information bin ich jetzt zu dem Ergebnis gekommen. Der Grund ist vermutlich eine Abwehrschwäche( Stress oder so in der Art) sonst wäre nichts passiert. Bleibt die Boreolose würde das Antibiotika die Darmbakterien ... Ich mache es kurz. Im schlimmsten Fall bekommt man Fieber und ist am Ende - laufen lassen ohne Antibiotika- gesund, oder tot. Wobei ich nicht weiß ob Holundersaft so schädlich ist wie Fieberzäpfchen, oder harmlos. Letztlich muss jeder selbst entscheiden wie man das gefährliche Spiel spielen will. Ausweichen geht leider nicht.Dann stand da auch was zu Ozon Therapie. Ich meine Ozon hätte Antibiotika Konkurrenz machen können. Obgleich billiger und weniger Darmbakterien belastend. Leider ist das gerade vom Bundesgesundheitsministerium verboten worden. Petition dazu läuft wen es interessiert. (openpetition/eigenblut-therapie)
- Dieter Berweiler, am 08.01.2019Liebe Sarah,
eine Rickettsien-Infektion ist wie eine Borreliose eine parasitäre Infektion. Bei parasitären Infektionen spielt der Lebensraum, das Milieu, sprich ihre innere „Körpersauberkeit“ eine wichtige Rolle. Die gleiche Bedeutung kommt dem Darm zu als Sitz des Immunsystems und der Fähigkeit der Nährstoffresorption.
Rikettsien alleine mit komöopathischen Mitteln zu behandeln halte ich für wenig erfolgversprechend, da an den Grundvoraussetzungen und Ursachen durch diese Therapie nichts korrigiert und verbessert wird. In Verbindung mit einer umfassenden Ursachentherapie macht das jedoch viel Sinn.
Eine Rickettsientherapie ist sehr ähnlich gelagert wie die Borreliosetherapie. Beseitigen sie die Fäulnis im Darm, stellen sie die Darmintegrität wieder her, korrigieren sie ihr Biogenom (Darmflora), versorgen sie den Körper mit entsprechend ausreichenden Vitalstoffen, entsäuern sie, entgiften sie, stützen sie ihre Ausleitungsorgane und gehen sie natürlich auch direkt gegen die Rickettien vor.
Viel Erfolg
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler, Heilpraktiker, Dipl.-Ing.(FH) - Sarah, am 08.01.2019Sehr geehrter Herr Berweiler,
welche Möglichkeiten sehen Sie bei der Behandlung von Rikettsien? Mit Homöopathie hatte ich bislang leider keinen Erfolg.
Vielen Dank schon im Voraus.
Ihre Sarah - Dieter Berweiler, am 15.08.2018Liebe Frau Mangione,
als Erstes gibt es zu bemerken, daß Sie nicht auf Borrelien, sondern auf Borrelien-Antikörper getestet wurden. Antikörper haben Sie anscheinend. Das sagt dann aus, dass Sie schon mal Kontakt mit Borrelien hatten. Das war es aber auch schon, was man dazu sagen kann. Ob im Moment eine Infektion mit Borrelien stattfindet, stattgefunden hat oder es etwas anderes ist, kann weder bestätigt noch dementiert werden. Auch lässt es keine Aussage zu, ob Ihr Immunsystem das regelt. Vermutlich schon, aber eben nur vermutlich.
Wenn Sie sonst keine Symptome haben, würde ich das Kräuterelixier „Lapparia“ 2 x tgl 2 Tropfen einnehmen und zusätzlich auf die Stichstelle auftragen – abwarten und weiter stillen.
Sollten Sie grippeähnliche Symptome bekommen oder plötzlich wandernde Gelenkschmerzen auftreten, dann wäre eine angemessene Therapie sinnvoll. Aus meiner Sicht natürlich eine Naturheilkundliche. Letztendlich müssen Sie das selbst entscheiden. Bei der naturheilkundlichen Therapie wäre das Stillen i. d. R. möglich.
Eine Darmsanierung ist immer sinnvoll, auch parallel zum Stillen. Genauer gesagt, ganz besonders während des Stillens. Denn dadurch bekommt der Säugling alles Gute über die Muttermilch mit. Beim Ausleiten sollten Sie sehr sanft vorgehen, aber auch das ist problemlos und gefahrlos während des Stillens möglich.
Lg Dieter Berweiler - Ramona Mangione, am 14.08.2018Sehr geehrter Herr Berweiler,
ich habe Ihren Artikel mit großem Interesse gelesen. Ich habe vor ca. 4 Monaten einen "Mückenstick" an meinem Bauch entdeckt und diesem keine weitere Beachtung geschenkt. Nachdem der Fleck aber immer größer wurde (obwohl er z.T. gar nicht mehr sichtbar war), bin ich dann doch mal zum Arzt gegangen. Nach einem Test auf Borreliose, der positiv ausgefallen ist, soll ich mir nun das Rezept für das Antibiotikum abholen. Ich halte rein gar nichts von Antibiotika und zudem: ich habe ansonsten keine Beschwerden. Kann es sein, dass mein Körper das mit sich ausmacht? Gegen eine Darmsanierung und das Ausleiten von Giftstoffen habe ich prinzipiell nichts. Auch eine Ernährungsumstellung (ich habe mich bereits 2 Jahre gluten- und laktosefrei ernährt) würde ich machen. Momentan stille ich jedoch noch und nun bin ich hin und her gerissen, ob und wann ich mit der Therapie beginnen soll, da ich ja vermutlich abstillen müsste und meine Kleine das gar nicht gut finden würde.
Konkret: muss eine Therapie erfolgen? Was passiert, wenn ich nicht abstille während der Therapie? Wie lange kann ich noch abwarten?
Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühungen
Liebe Grüße
Ramona Mangione - Online-Redaktion, am 16.05.2018Liebe Leser,
wie die letzten Anfragen zeigen, gehen bei uns immer wieder Anfragen zu Therapeuten in bestimmten Regionen ein. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese nur begrenzt beantworten können. Bitte nutzen Sie dafür unsere Therapeutensuche. Ganzheitliche Ärzte finden Sie unter http://www.naturheilmagazin.de/aerzte.html, Heilpraktiker unter http://www.naturheilmagazin.de/therapeuten.html
Ihre Online-Redaktion - Peter Terstegge, am 12.05.2018Hallo,
Auch ich habe mich wahrscheinlich mit Borillose infiziert.
Viele verschiedene Anzeichen deuten darauf hin. Auch habe ich festgestellt, daß ich schon über ein Jahr eine niedrige Körpertemperatur habe. Ich messe unter der Zunge Temperaturen um die 35 - 36° C. Auch habe ich in interwallen auftretenden starken Nachtschweiß, jedoch die Körpertemperatur erhöt sich nur sehr gering.
Können Sie mir einen Facharzt in der Nähe von Dortmund nennen, wlcher auch Kassenpatienten behandelt. Mein Hausarzt hat eine Testung auf Borillose abgelehnt.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Terstegge - Andrea, am 01.04.2018Lieber Herr Bergweiler,
Bei mir ist nach jahrelangem Irrlauf letzte Woche Borreliose diagnostiziert worden, gibt es im Umlauf von Schweinfurt einen Mediziner oder Therapeuten , den Sie empfehlen können? Ich hab mich jetzt schon drei Tage durch‘s Netz und Ihre Berichte gelesen und möchte kein Antibiotikum nehmen.
Danke und liebe Grüße, Andrea - Anne Weineck, am 30.03.2018Vielen Dank für diesen Artikel!
Mein Mann hat zahlreiche Symptome und auch eine Wanderröte vor 3 Jahren nach Zeckenstich
Ich bin mir fast sicher, das er Borreliose hat.
Ich suche nach einem geeignetem Arzt/ Therapie.
Wir haben diandnostisch und therapeitisch noch nichts gemacht..
Wir wohnen in 173.. Nord-Osten Deutschlands... können sie uns einen spezialisierten Therapeuten auf dem Gebiet empfehlen?
Leider ist es zu Ihnen einmal quer durch Deuschtland und eine Sitzung ist sicher nicht ausreichend?! - Online-Redaktion, am 24.11.2017Liebe Jülide,
ob eine Borreliose hinter Ihren Beschwerden steckt, lässt sich aufgrund Ihrer - wenngleich sehr ausführlichen - Beschreibung nicht beurteilen. Sehr wohl aber ist ersichtlich, dass Ihr Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist. Welche Therapie in Ihrem Fall sinnnvoll ist (z.B. die oben genannte Darmsanierung, gesunde Lebensführung), kann nur individuell aufgrund einer Untersuchung entschieden werden. Aus Ihrem Bericht spricht eine gewisse Skepsis gegenüber Ihrem Heilpraktiker. Ein Ansatz könnte daher sein, sich nach einem ganzheitlichen Arzt oder Heilpraktiker umzusehen, dessen Verfahren Ihnen mehr entsprechen.
Kontaktdaten finden Sie bei uns unter http://www.naturheilmagazin.de/aerzte.html und http://www.naturheilmagazin.de/therapeuten.html
Alles Gute wünscht Ihnen
Ihre Online-Redaktion - Jülide, am 19.11.2017Seit nun längerer Zeit leide ich unter einem chronischen Aufstoßen und Übelkeit. Mir ist Tag und Nacht übel. Jedes Mal wenn ich meinen Speichel schlucke, stoße ich Luft auf. 2014 war ich in der Türkei im Urlaub, wo ich relativ oft von Mücken gestochen wurde. An auffällige Rötungen kann ich mich zwar nicht erinnern, dennoch schließe ich nicht aus, dass sie "normal" rot waren. Kurz vor der Abreise hatte ich eine hohe Appetitlosigkeit, welche sich bis heute zum Teil hält. Ich habe immer gerne und Gut gegessen. Nach meinem Aufenthalt im Deutschen Krankenhaus wurde eine Magenspiegelung veranlasst, wo kein auffälliges Ergebnis zustande kam. Seitdem habe ich 5-7 Kilo abgenommen. Im Krankenhaus wurde eine leichte Schilddrüsenunterfunktion erkannt, welche man aber der Meinung war, sie nicht zu behandeln. Letzen Winter hatte ich dann schlimmes Herzrasen. Und nach längerem Leiden und erneutem Notaufnahmen Besuch im Krankenaus, wurde erkannt, dass ich eine schlimme Unterfunktion der Schilddrüse habe und wie ich seither Leben konnte. Mein Schluckaufartiges Rülpsen wurde Immer als "Sowas habe ich noch nie gesehen" betitelt und außer Acht gelassen. Vergangene Woche war ich beim Heilpraktiker um nach einem anderen Weg zu schauen, da ich von den Ärzten enttäuscht war. Nach kurzem Check-Up stellte er eine Borreliose fest. Mit diesem Befund ging ich erneut zum Hausarzt, der meinte, dass dies sein könnte. Er bittet mich darum mein Blut zu testen. Ich machte ihm klar, dass ich jahrelang schon leide und oft genug Blut abgenommen bekommen habe. Er bat darum, weil er mich diesmal auf Boreliose testen will, statt wie üblicher Weise auf Magnesium, Calcium, etc... In vorherigen Tests fiel auf, dass ich einen hohen Allergiewert im Blut habe, woher dieser kommt, ist nicht bekannt. Der Heilpraktiker bei dem ich war, arbeitet ohne Medikamente und nur auf spirituelle Art und Weise. Dies schien mir nicht seriös, da ich denke jahrelanges Leiden könnte nicht mit Lichttherapie behandelt werden. Nun schlägt mein Hausarzt vor, nach dem Blutergebnis, Antibiotika zu nehmen. Hier lese ich aber, dass dies kaum anschlägt. Wenn ich richtig gezählt habe, habe ich dieses Jahr bestimmt 10-12 Mal Blut abgenommen bekommen. Anfang des Jahres habe ich auch den Hausarzt gewechselt, da ich wirklich gar nicht zufrieden war. Dieser wollte mir Schmerztabletten verschreiben, die an Krebsleidende Kinder bekommen! Ich bin nun 19 Jahre alt und habe das Gefühl mein Leben zu verpassen, weil ich sehr leide unter dieser Übelkeit. Ich habe bereits einen Ernährungsplan erhalten, doch meine Übelkeit hält sehr an.
- Nadja Forster, am 15.09.2017Sehr geehrter Herr Berweiler,
vielen Dank für Ihren interessanten Ansatz, den ich gern ausprobieren möchte. Hilfreich ist dazu sicherlich Ihr Therapieplan. Der von Ihnen angegebene Link funktioniert jedoch leider nicht: http://www.dieter-berweiler.de/fileadmin/pdfs/HP/Therapieplan_Borreliose.pdf .
Es wäre toll, wenn das Problem behoben werden könnte oder Sie mir das PDF per Mail zusenden könnten.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße Nadja Forster - Inge Balk, am 14.09.2017Lieber Herr Berweiler,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe eine Heilpraktikerin in meiner Nähe gefunden, welche nach Dr.Klinghardt behandelt. Meinen Sie sie kann herausfinden was die krankmachenden Ursachen sind?Ich war nochmal bei dem Borreliose-Arzt und er hat mir folgendes gesagt: ich soll für ca.60 Tage einnehmen: Toxisorb, Alisian, 3x 10Tropfen Karde tägl., Alpha Engergie 2x2 Kapseln. Er sagt die Antibiotika haben nicht gewirkt weil ich eine Schwermetallvergiftung habe!? Aufgrund Blutuntersuchung habe ich keine Parasiten. Sollte die Ursache meiner Beschwerden Arthrose sein, hab ich doch eh keine Chance auf Besserung. Ersatzfuss- Zehengelenke gibt es nicht und die Versteifung der Füsse, wie die Orthopäden mir empfohlen haben trau ich mir nicht.
Bitte sind Sie doch so freundlich u.sagen mir wo ich Ihren Therapieplan finde oder schicken mir diesen. Vielen Dank. - Dieter Berweiler, am 05.09.2017Liebe Frau Balk,
bei Ihnen scheint eine Mischung vieler Ursachen die Beschwerden zu verursachen. Die Polyneuropathie ist eine Erkrankung des autoimmunen Formenkreises, auf der sich eine Parasitose wie eine Borreliose ansiedeln kann. Ob Sie andere Parasiten haben, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, wie viele andere Patienten auch. Aufgrund Ihrer Darmdysbiose haben Sie vermutlich einen Vitalstoffmangel und eine Darmfehlbesiedlung. Das alles ist vermutlich noch kombiniert mit einer Vergiftung, die ihrerseits mit Bestandteil der Autoimmunerkrankung ist. Kurzum – ein komplexes Geschehen.
Die von Ihnen aufgeführten naturheilkundlichen Präparate reichen bei weitem nicht aus, um Ihr Krankheitsbild auch nur annähernd erfolgversprechend zu behandeln. Leider hilft die Schulmedizin auch nicht weiter, wie Sie leidlich erfahren durften.
Die Aussage Ihres Arztes, dass die Beschwerden nicht von Borrelien kommen, lässt sich so nicht halten, da die Therapie viel zu kurz war. Allerding könnten es auch andere Parasiten sein, kurz, man weiß es einfach nicht.
Bitte lesen Sie meinen Therapieplan zur ganzheitlichen Behandlung der Borreliose, den Sie gerne bei mir anfordern können. Dort finden Sie auf viele Fragen eine Antwort. In Ihrem Fall gilt es als erstes, die krankmachenden Ursachen zu finden und diese zu eliminieren. Gleichzeitig mit einer Symbioselenkung und einer Vitaminkur den Darm zu stabilisieren und das Immunsystem zu regenerieren. Parallel sollte mit einer Ausleitungstherapie die Entgiftung und Milieusanierung stattfinden.
Das bedarf einiges an Aufwand und Zeit. Meist dauert eine solche Behandlung ein bis zwei Jahre.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Berweiler
Heilpraktiker, Dipl.-Ing.(FH) - Inge Balk, am 30.08.2017Lieber Herr Berweiler,
ich habe Brennen u. Druck in beiden Füssen vorallem wenn ich gehe. Aufgrund dieser Beschwerden habe ich schon viele Arztbesuche hinter mir.
Ich habe div. Diagnosen wie: Polyneuropathie, Arthrose, Fussgewölbe abgeflacht wegen Hallux.Ich war auch bei einem Arzt welcher auf Borreliose spezialisiert ist. Er führte den LTT-Test durch, dieser war mit 3 Borrelien positiv, allerdings waren die SI_Werte 3,6 3,8 3,9, die vierte Borrelie war unter 3 also negativ. Quecksilber war leicht erhöht, Blei war bei 37.Ich führte folgende Therapie durch: Kardetinktur 3x20 TropfenToxsorbEnzyme u.Darmbakterien Leaky Gut u ProbiolaktAllisianDies brachte nach 6 wöchiger Einnahnme keine Besserung deshalb verschrieb mir der Arzt Minocyclin und Quensyl . Diese nahm ich 4 Wochen ein, aber leider wieder ohne Erfolg, ausser das mein Magen total übersäuert ist und die Mundwinkel rot u.eingerissen.Jetzt soll ich nochmal andere Antib. einnehmen! Das mach ich nicht. Lt. Arzt soll es das gewesen sein.. also kommen die Beschwerden nicht von den Borrelien. Aber die Polyneuropathie hat doch eine Ursache ist keine eigenständige Krankheit. Bitte sagen Sie was ich noch tun kann oder welcher Arzt mir helfen kann, ich habe null Lebensqualität das ich mich nicht bewegen kann. Ich hab schon viele Geld investiert. Schmerzmittel haben null Wirkung. Ich wohne in 92637 Weiden (Bayern) Vielen Dank. - Dieter Berweiler, am 16.08.2017Hallo Frau Mittelberger,
Borrelien und andere Parasiten können auch von Schnaken, Bremsen, Flöhen und anderen stechenden Insekten übertragen werden.
Als Erstes ist anzumerken, dass das Erythema migrans (Wanderröte) "nur" eine Immunreaktion gegen einen Fremdeiweißeintrag ins Gewebe darstellt. Das Erythema migrans "gilt" als sicheres Zeichen für eine Borreliose. Das ist jedoch ein Postulat, d.h. es wird behauptet, dass es so ist. Belege dafür gibt es nicht. In über 50 % der Borrelieninfektionen gibt es kein Erythema migrans. Es ist auch nicht klar, ob bei anderen Parasiten ein Erythema migrans auftritt oder das Erscheinen des Erythems z.B. von der Blutgruppe oder anderen Faktoren abhängt. Kurz um: Man weiß eigentlich recht wenig darüber.
Es ist daher nicht auszuschließen, dass bei Ihrem Stich auch ein Parasit übertragen wurde. Im Moment ist es so zu bewerten, dass Ihr Immunsystem reagiert - also ein sehr gutes Zeichen. Sie unterstützen das ja auch mit den Präparaten, die Sie aufgezählt haben. Ich weiß natürlich nicht, wie Ihre Vitaminversorgung aussieht, ob diese noch gestützt werden sollte. Auch verbrauchen Entzündungen immer Zink. Da würde ich Ihnen empfehlen Zink noch zu substituieren.
Gegen den eventuellen Parasiteneintrag ins Gewebe empfehle ich meinen Patienten das Lebenselixier Lapparia 2x3 Tropfen tgl. oral einzunehmen und zusätzlich die betroffene Stelle mit 1-2 Tropfen einzuschmieren. Das 14 Tage darüber hinaus bis das Erythem ganz verschwunden ist, wenigstens jedoch 6-8 Wochen. Lesen Sie bitte auch meine Ernährungsrichtline, um Ihren Darm zu entlasten und damit auch Ihr Immunsystem zu stärken. Die aktuelle Information können Sie gerne bei mir anfordern.
Mit freundlichen Kräutergrüßen
Dieter Berweiler
Heilpraktiker, Dipl.-Ing. (FH) - Brigitte Miltenberger, am 15.08.2017Hallo, heute habe ich einen roten Ring - deutlich wie die Wanderröte am Oberarm hinten entdeckt. Voraus ging ein Insektenstich - keine Zecke - vor 14 Tagen. Der Stich hatte sich hoch entzündet und Wundflüssigkeit abgesondert. Er heilte fast ab, bis er vor ein paar Tagen plötzlich wieder zu jucken begann und sich dieser rote Ring, etwa 3 cm Abstand bildete. Ich mache Umschläge mit Kolloidalem Silber, nehme Vitamin C, OPC und Vitamin A+E. Homöopathisch Echinacea Comp. der Fa. Heel und Lymphomyosot. Kann es wirklich sein, dass von einem Insekt, das keine Zecke ist, Borreliose übertragen wurde oder sind das andere Bakterien? Wenn ich zum Arzt gehe, bekomme ich Antibiotika, wobei ich auf viele Antibiotika allergisch bin (alle ß-Lactame). Wie soll ich vorgehen? Sonstige Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit oder Kopfschmerzen habe ich nicht.
Ich zog auch schon in Erwägung Borrelia Nosode D200 zu nehmen.
Danke und herzliche Grüße Brigitte Miltenberger - Dieter Berweiler, am 25.07.2017Liebe Judith,
Magnesiumstearat behindert die Resorptionsleistung der Vitalstoffe im Darm und ist für keinen Menschen ratsam, und schon gar nicht für Borrelios-Erkrankte. Die Klösterl-Apotheke in München bietet Alternativen zu Euthyrox an auf natürlicher Basis.
Zu Ihrer zweiten Frage: Einen Borreliose-Spezialisten im Raum Wien kenne ich leider nicht.
Viel Erfolg wünscht Ihnen
Dieter Berweiler - Judith, am 23.07.2017Guten Tag,
Sie schreiben, dass man bei Borreliose auf Magnesiumstearat verzichten sollte. Nun leide ich aber zusätzlich unter Hashimoto und muss Schilddrüsenmedikamente nehmen. Ich nehme Euthyrox (112). Gibt es ein anderes, vergleichbares Medikament (schulmedizinisches) ohne Magnesiumstearat?
Vielen Dank für Ihre Hilfe! - Judith, am 22.07.2017Lieber Herr Berweiler,
kennen Sie einen erfahrenen Borreliose-Spezialisten/Spezialistin mit naturheilkundlichem Ansatz im Raum Wien, Österreich?
Vielen Dank für Ihre Hilfe! - Dieter Berweiler, am 17.07.2017Lieber Herr Lübbe,
ob das Abschalten des Auges durch Borrelien bedingt ist, erachte ich als reine Spekulation. Das kann reichlich andere Ursachen haben, vor allem Verschlackung und Vergiftung.
Da drängt sich die erste Frage auf, ob ihre Tochter pro 20 kg Körpergewicht auch 1 l "Waschwasser" trinkt. Des Weiteren hat sie vermutlich eine lymphatische Konstitution, sprich hat blonde Haare oder ist brünett, hat helle Haut und blaue, grüne Augen oder eine Mischfarbe mit diesen.
Das geschwollene Knie kann auch andere Ursachen haben, es muss nicht die Borreliose sein. Der Gang zum Rheumatologen ist zwar nachvollziehbar, aber nicht zielführend, da keine ursächliche Therapie angeboten wird, sondern wie sie es selbst beschreiben eben nur Kortison. Bitte sehen sie es mir nach, aber ob die Ernährungsberatung ihres indischen Akupunkteurs im Falle ihrer Tochter die richtige ist, kann ich leider nicht beurteilen.
Bitte fordern sie bei mir die aktuelle Ernährungsrichtlinie an.
Naturheilkundlich ist ihre Tochter sicher gut zu behandeln – wie fast jedes Kind. Welches Therapiekonzept speziell für ihre Tochter das richtige ist, kann ich erst nach einer ausführlichen Anamnese sagen. Da bitte ich um Verständnis.
Aber jede parasitäre Therapie bedeutet grundsätzlich erstmal:
A Artgerechte Ernährung
B Säure-Basen-Regulation
C Vitaminsubstitution
D Darmsanierung (nicht Reinigung)
E Parasiten-Jagt
F Schwermetallausleitung (z.B. Belastungen durch Impfungen)
All dies dient dazu, den Körper wieder in die Regulation zu bringen. Gerne helfe ich Ihnen weiter. Bei Kindern geht es erfahrungsgemäß fast immer einfach und schnell.
Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass in den Bluttests immer die Antikörper und bisher zumindest nicht die Borrelien selbst erfasst werden. Das ist ein Riesenproblem, ist aber eben so.
Liebe Grüße
Dieter Berweiler - Karsten Lübbe, am 12.07.2017Guten Tag Dieter Berweiler, bei unserer 8-jährigen Tochter sind angeblich Borrelien bzw. die Antikörper in der Blutprobe nachgewiesen worden. Zunächst hatte uns der Kinderarzt zum Augenarzt geschickt, weil das rechte Auge immer wieder sich abschaltete. Dort wurde eine Eintrübung festgestellt, die wahrscheinlich auf die Borreliose zurückzuführen zu sein scheint. Sowohl in der Uni-Augenklinik als auch bei einem anderen Augenarzt wurde empfohlen, die Linse bei ihr auszutauschen. Wir waren zwischenzeitlich bei einem befreundeten Akkupunkteur und Naturheiltherapeuten. Er hatte einige Punkte bei unserer Tochter gelasert. Nun ist seit etwa 3,5 Wochen das Knie geschwollen und die Augenärztin schickte uns zur Abklärung zu einem Kinderrheumatologen. Eine juvenile Arthritis scheint ausgeschlossen, aber wiederholt wurde eine Bluttest gemacht, der Borrelien nachgewiesen hatte. Der Rheumatologe möchte mit einer Cortison-Injektion ins Knie die Entzündung stoppen und anschließend medikamentös behandeln, halt schulmedizinisch. Gibt es für unsere Tochter eine alternative Behandlungsmöglichkeit? Ernährungsberatung kann der indische Akkupunkteur in Kiel leisten, denke ich.Herzlichen Dank und herzliche GrüßeKarsten Lübbe
- Dieter Berweiler, am 07.07.2017Liebe Frau Eggert,
es ist schon vorstellbar, dass Radon die Verträglichkeit der Kardentinktur herabsetzt. Aber ehrlich, ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Viel häufiger liegt es daran, dass z.B. der verwendete Alkohol nicht Bio ist, dass das Wasser für die Tinkturenherstellung nicht „rein“ genug ist und dann eventuell pflanzliche Inhaltsstoffe in der Lösung ausfallen und so wertvolle balancierende Inhaltstoffe verloren gehen. Dann kommt es auf den Standort an, an dem die Pflanze wächst, das dort vorherrschende Kleinklima, die Wasserversorgung, die Sonnenscheindauer, die Bodenqualität, das Messer, mit dem die Pflanze geschnitten wird …. Es gibt also sehr viele Einflussfaktoren, die die Qualität einer Tinktur bestimmen.
Weihrauch ist sicherlich eine Möglichkeit, Magen und Darmschleimhaut symptomatisch zu beruhigen. Gleichzeitig sollte man Zusatzstoffe, die die Schleimhaut reizen wie z.B. Lebensmittelzusatzstoffe – die sogenannten E-Stoffe –, generell aus den Lebensmitteln verbannen und gleichzeitig nur Lebensmittel zu sich nehmen, die biochemisch im Darm verstoffwechselbar sind.
Es ist durchaus denkbar, dass Borrelien in B Lymphozyten vorkommen. Inwieweit sich das auf die entsprechende Immunantwort auswirkt, wird die Forschung hoffentlich bald herausfinden.
Eine naturheilkundliche Borreliosebehandlung dauert nach meinem Erfahrungsschatz 1 bis 2 Jahre und länger. Während dieser Zeit werden Karde & Co. samt allen anderen 8 bis 15 von mir eingesetzten Präparate eingenommen. Eine Einnahmenpause nach 3 Monaten ist bei meiner Therapie weder vorgesehen noch therapeutisch sinnvoll.
Liebe Grüße
Dieter Berweiler - Dieter Berweiler, am 03.07.2017Liebe Clarissa,
von solchen und ähnlichen Odysseen von Betroffenen höre ich fast wöchentlich in meiner Praxis. Leider ist es so, dass die Tests zwar sehr spezifisch sind, d.h. der Erreger wird deutlich von anderen unterschieden, aber leiden nur ca. 70 bis 80 % sensitiv sind. Das wiederum bedeutet, dass 20 bis 30 % der Testungen entweder falsch positiv bzw. falsch negativ sind. Also alles andere als verlässlich. Daher sollte man verschiedene Tests kombinieren – vor allem auch mit dem LTT. Aber trotzdem gibt es hier keine 100%ige Zuverlässigkeit.
Weiterhin könnte es ja auch sein, dass die Zecke wirklich keine Borrelien übertragen hat, sondern einen anderen Erreger wie z.B. Bebesien, Bardonella, Ricketsien etc, die die Beschwerden auslösen. Dann wäre Ihr Test zu Recht negativ.
Also alles sehr unbefriedigend.
Hinzu kommt, dass die Hausärzte sich meist nicht hinreichend gut in der Thematik auskennen und „Spezialisten“, die „nur“ Schulmedizin anwenden, keine nachhaltigen Erfolge haben können, da die Antibiotikatherapie nie die Grundvoraussetzungen der Borreliose beseitigt. Daher kommt es immer wieder zu Rezidiven.
Ich kann ihnen nur anraten, eine ganzheitliche naturheilkundliche Therapie zu wählen, die alle Regelkreisläufe im Körper berücksichtigt. Parallel dazu sollten Sie Ihre Ernährung optimieren und alle Giftstoffe aus Ihren Lebensmitteln verbannen. Gerne können sie sich auf meiner Homepage meinen zwar nicht mehr ganz aktuellen Therapieplan zum Lesen herunterladen. Diesem können Sie viele wertvolle Informationen entnehmen, die Ihnen sicherlich weiterhelfen. Wenn Sie in ihrer Nähe keinen geeigneten Therapeuten finden, begrüße ich Sie gerne bei mir in der Praxis in Stuttgart.
Ihr Dieter Berweiler - Margret Eggert, am 28.06.2017Liebe Leser und lieber Herr Berweiler,
zunächst mal zwei Erkenntnisse, auf die ich selbst gekommen bin:
Die Karde und manche anderen (Heil-)Pflanzen nehmen Radioaktivität aus dem Boden auf, auch die Tinkturen! Ich wohne auf einem Verwerfungsgebiet und wunderte mich, dass ich eine aus selbstgezogenen Karden hergestellte Tinktur nicht gut vertrug, eine neu gekaufte dagegen wohl,bis mir einfiel, dass die Karden dort gewachsen waren, wo viel Radon aus dem Boden kommt (Mittelgebirge, Bergisches Land). Wichtig also: die Tinkturen sämtlichst davor zu schützen, es gibt dafür Möglichkeiten, die ich auch gern nenne, falls Interesse besteht.
Sollte der Magen, bedingt durch die Borreliose, Probleme bereiten (Übelkeit, Druckgefühl), hilft es, Weihrauchharzstückchen im Mund zergehen zu lassen. Diese Weihrauchstückchen habe ich in meiner Apotheke bekommen, das ist allerdings schon einige Zeit her.
Eine Frage zur Behandlung habe ich auch noch: Storl schreibt, dass sich die Borrelien nicht nur in die Erythrozyten, sondern auch in B-Lymphozyten einnisten können.Wenn das so ist, kann der Körper ja gar nicht mehr erkennen, wieviel "Polizei" er überhaupt noch im Einsatz hat. Wäre es dann richtig,im Anschluss daran, wenn die Borrelien in den Zellzwischenräumen nicht mehr nachweisbar sind, eine zweite Behandlungsphase einzuleiten, in der man ein Mittel wie c-Amp D 30 von der Firma Sanum-Kehlbeck,das die Zellwände öffnet, einzusetzen, damit Karde&Co die Borrelien, die sich in den Zellen versteckt halten, finden kann? Und wäre eine Behandlungspause nach spätestens 3 Monaten dann überhaupt ratsam, wenn der Körper seine Eindringlinge nicht erkennen kann?
Ich hoffe, der Beitrag ist hilfreich für alle Betroffenen!
Margret Eggert - Margret Eggert, am 24.06.2017Lieber Herr Berweiler,
durch das Buch von Herrn Storl und das Internet bin ich zu Ihnen gelangt und habe vor ca 8 Tagen auch das "Gesamtpaket" für chronische Borreliose bestellt und nehme es; mein Befinden ist immer noch sehr wechselnd, ich will geduldig sein.
Interessant ist, dass ich (seit Juni) fast täglich Zecken mitbekomme, obwohl ich den direkten Kontakt mit Grünem - leider - so gut es geht vermeide. Es ist mir schon mal in einem Jahr so ergangen, dann habe ich immer Notakehl D 5 genommen und Ruhe gehabt. Diesmal habe ich einen Zeckenbiss falsch eingeschätzt und einen Re-Infekt bekommen (die vorher vorhandenen Beschwerden hatte ich nicht mit Borreliose in Verbindung gebracht). Das Tückische ist, dass die Zecken, die mich befallen, immer so klein sind, dass ich sie gar nicht erkennen kann. Entweder macht sich der Biss durch etwas Jucken oder eine kleine rote runde Stelle bemerkbar. So bleibt mir nichts anderes übrig, als die Stelle auszukratzen (mit den Nägeln), meist mehrfach, und immer wieder mit Propolis zu desinfizieren. Was kann ich tun, damit die Zecken mich nicht so lieben?
Meine Homöopathin, die mich unter das Konstitutionsmittel Natrium Muriaticum gestellt hat (z.Z. LM 28) möchte nicht, dass ich ein weiteres homöopathisches Mittel einsetze. Ich möchte mich so gern wie ein normaler Mensch in der Natur bewegen! - Weil ich glaube, dass es auch vielen anderen Menschen so geht, habe ich diesen Brief geschrieben.
Margret Eggert - Clarissa, am 22.06.2017Liebes Naturheilmagazin-Team,
ich wurde in meinem Leben schon unzählige Male von Zecken gestochen. Als Kind schon regelmäßig, aber nie kam es zu Beschwerden.Inzwischen bin ich 33 Jahre.Letzten Sommer stach mich eine Zecke in den Nacken. Da sich keine Wanderröte zeigte, hielt kein Arzt eine Behandlung für nötig, nichteinmal einen Test wollten die Ärzte zunächst machen.Nach dem Stich im Nacken hatte ich aber heftigste Beschwerden und Symptome - vor allem Hals und Nacken betreffend. (massive Verspannungen, Lymphknotenschwellungen, Ohrenschmerzen, Gewichtsverlust von 10Kg bis ins Untergewicht, Gastritis und Duodenitis - alles über Monate anhaltend - zudem Gedächtnisstörungen und Vergesslichkeit).Letztlich konnte ich erst 6 Monate später einen Arzt zu einem Test (das war dann der ELISA) überreden. Dieser fiel negativ aus und somit war das Thema bei meinen Ärzten komplett vom Tisch und alles als psychosomatisch abgetan.Nun hatte ich im Frühjahr diesen Jahres einen erneuten Stich oberhalb der linken Brust. Ich habe die Zecke in einem Labor testen lassen und sie enthielt nachweislich Borrelien.Auch diesmal hielt es aufgrund fehlender Wanderröte kein Arzt für nötig zu behandeln oder zu Testen. Ich organisierte mir einen Termin bei einem Borr.-Spezi und überredete ihn zu einem WesternBlot auf eigene Rechnung - auch dieser fiel negativ aus und wieder hieß es ich hätte halt irgendwas anderes. Nun stellen sich seit eben diesem neuen Stich starke Beschwerden im linken Arm- und Schulterbereich ein. Gelenkknacken, Hervortreten der Venen bzw. Anschwellen, Nervenentzündung im Arm und Karpaltunnelsyndrom, dazu Schwindel und Benommenheit. Können Sie mir einen Rat geben, wie ich weiter verfahren könne. Kann ich mich auf einen negativen ELISA und negativen WesternBlot verlassen und es als Zufall ansehen, dass sich nach einem Zeckenstich in den Nacken starke Beschwerden im Halsbereich und nach einem weiteren Zeckenstich oberhalb der linken Brust nun massive Beschwerden im linken Schulterbereich und im linken Arm einstellen.Ich bin im Moment sehr verzweifelt, da ich schon gar nicht mehr weiß. welchen Arzt ich noch mit meinen Beschwerden "belästigen" soll.. - Dieter Berweiler, am 31.05.2017Liebe Kiki,
das mit den Test, egal welcher, ist so ne Sache. Sie sind allesamt nicht 100 % zuverlässig. Auch die Aussage, dass ohne die IgG bzw. IgM keine Infektion stattgefunden hat, muss nicht stimmen. Der Antikörpertest misst wie der Name schon sagt Antikörper, die vom Immunsystem gebildet werden. Sollte Ihr Immunsystem keine Antikörper gebildet haben, weil es dazu einfach nicht Instande war, findet man einfach keine. Oder es war tatsächlich kein Erreger drin. Dagegen würde allerdings der positive LTT-Test sprechen. Der wiederum könnte auch falsch positiv sein. Fazit: Man kann es einfach nicht mit Bestimmtheit sagen.
Ihre Symptomatik deutet auf eine eventuelle Infektion hin. Das Beschwerdebild könnte aber auch von z. B. Vitalstoffmangel kommen.
Sie merken, es gibt einfach keine eindeutige Diagnostik. Das gernau macht die Sache so komplex und verwirrend.
Da Antibiotika nur ein Zeitgewinn sind und keine ausheilende Therapie wurde ich Ihnen zu einer naturheilkundlichen Therapie raten, die alle möglichen Ursachen in der Therapie berücksichtigt. Lesen Sie dazu bitte auch meinen Therapieplan.
Liebe Grüße Dieter Berweiler - Kiki, am 30.05.2017Liebes Naturheilmagazinteam,
der Lymphozytentransformationstest ergab, dass ich eine aktive Borreliose habe. Die Symptome Hüft- und Knieschmerzen, Achillesfersenschmerzen und Rückenschmerzen sprechen dafür. Zwei weitere Antikörpertests (IGg und IGm) waren negativ. Mein Hausarzt sagt, dass ohne Antikörper keine Infektion vorliegen kann. Haben Sie eine Erklärung? Mit freundlichen Grüßen